Auf Grund der Datenschutzverordnung, 25.05.2018, verzichte ich auf Verlinkungen auf andere Webseiten. Alternativ markiere ich die Schlagwörter fett.
Möchtest du meinen Blog 1x wöchentlich oder 1x monatlich abonnieren, schreibe mir andrea@a-streit.de..
31.12.2025 Erst die Arbeit, dann das Vergnügen
Ein letztes Mal an der Kreidetafel stehen, zeichnen und Gäste animieren, mitzumachen. Der Markt schließt heute Nacht. Eine Marktsaison endet. Ob es sich für die Händler gelohnt hat, weiß ich nicht. Ich bin froh, dass sich mein beruflicher Auftrag auf zwei Stunden beschränkt und ich mich dann dem Silvesterfest widmen kann: Essen und trinken. Sich einen Platz suchen, wo ich einen guten Blick auf das Feuerwerk habe, das vom Dach des Konzerthauses auf dem Gendarmenmarkt in die Luft gebracht wird. Nach dem das vollbracht ist treffe ich und Brigit Bardot, die mich begleitet, Andrea und ihre siebenköpfige Silvestergruppe. Zusammen tanzen wir, schlürfen Glühwein und Sekt. Wir sind unanständig vergnügt. Die Leichtigkeit, die ich verspüre, kommt daher, das unsere Verbindung nur an Silvester besteht.
Happy New Year! Allen und mir.
30.12.2025 Zeichne auf dem WeihnachtsZauber am Gendarmenmarkt

29.12.2025 Zeichne auf dem WeihnachtsZauber am Gendarmenmarkt

28.12.2025 Pittiplatsch und Deutsche Theater
Zeichne auf dem WeihnachtsZauber am Gendarmenmarkt an der Kreidetafel die Märchenwaldfigur Kobold Pittiplatsch, den ich auch am 13.12.2024 (siehe Blogeintrag) mit seinen Freunden an die Kreidetafel des Marktes platzierte.

Anschließend gleich zum Deutschen Theater gefahren, um mit Nancy H. das Stück Halts Maul, Kassandra!, nach Texten und Liedern von Thomas Brasch, in der Regie von Thomas Kühnel und Jürgen Kuttner zu sehen. Fragmentarisch, manövriert sich das Theaterstück am Leben des Thomas Brasch entlang, der als deutscher Schriftsteller, Drehbuchautor, Regisseur, Dramatiker und Lyriker in die Geschichte der Deutschen Literatur des 20 Jahrhunderts eingeht. Sechs Darsteller, zwei Frauen, vier Männer, in schönen Kostümen auf einer Bühne, die durch ein zylinderhaften betonfarbenes Monstrum dominiert wird, das auch zur Projektion von Filmbilder dient. Im Bauch des Monstrums ist ein zu zwei Seiten durchgängiges Rechteck mit Gefälle eingearbeitet, dass die Darsteller auch als Spielfläche nutzen. Das Stück ist temporeich, witzig, leicht und tiefsinnig. Gern hätte ich einige gesprochene Worte – mir Wort für Wort gemerkt. So hieß es z.B. „Er (Brasch) lebte auf der Mauer, nicht rechts oder links davon“. Auch einige choreographische Einfälle hätt´ ich gern mittels einer Repeat-Taste mehrfach sehen wollen, wie die Szene mit der Engelprojektion, die ihn übergroß erscheinen ließ.
Über Thomas Brasch weiß ich nicht viel. Ich vermute, es hat mit seiner Ausreise aus der DDR im Jahr 1976 zu tun. Ich ging noch brav in die Schule. Spielte Völkerball, blinde Kuh und Topfschlagen. Ich war zu jung. Seinen Mentor Heiner Müller kannte ich dagegen sehr wohl. Er blieb in der DDR.
Das Stück, das keiner klassische Dramaturgie folgt: wie Einführung der Charaktere und dem Handlungsort, steigender Handlung mit Hindernissen und Konflikten, weiter zum Höhepunkt und der abfallenden Handlung bis zur Auflösung des Konflikts hat mich dennoch vergnüglich gestimmt. Was mir so wichtig ist am Theater, dass die Darsteller spielen wörtlich nehmen, das die Bühne ein Bild ist, das die Landschaft des Stücks wie ein gemaltes Gemälde abbildet.
Auch hat mich das Stück auf die Person Thomas Brasch neugierig gemacht, was auch nicht selbstverständlich ist.
Fazit:
Chapeau! Kleine Kritik an die Szene, in der die Darsteller von Brasch Lyrik zitieren. Brasch hätte seinen Mentor Heiner mehr auf die Finger gucken sollen.
27.12.2025 Zeichne auf dem WeihnachtsZauber am Gendarmenmarkt
Bei bedeckten Himmel um 2-3 Grad Celsius zeichne ich Lebkuchenmännchen, an der Kreidetafel des WeihnachtsZauber am Gendarmenmarkt. Brigitte Bardot kommt mich besuchen, was wir für ein gemeinsames Foto nutzen.

25.12.2025 Neues Haus des Berliner Ensembles
Mit Brigitte Bardot sehe ich das Theaterstück Herkunft, in der Regie von Stas Zhyrkov, im Neuen Haus des Berliner Ensembles. Theater am Weihnachtsfeiertag ist eine schöne Tradition, die ich schon mit meiner Mutter pflegte. Aber über diese Inszenierung zu schreiben nicht wert. Großes Problem, das Stück ist auf Grundlage des gleichnamigen Romans „Herkunft“ von Saša Stanišić entstanden. Das ist, als wollt ich aus einer schönen Malerei nun eine Bronzestatur erschaffen.
Fazit: Monologisierende Figuren. Spielen nicht, sprechen nur. War wie Hörbuch hören. Bin eingepennt, Brigitte auch.
24.12.2025 Weihnachtsoratorium
In diesem Jahr begebe ich mich mit Brigitte Bardot zur Christvesper mit Auszügen aus dem Weihnachtsoratorium von Johannes Sebastian Bach. Ich bin ganz hin und weg, jedes Mal wenn der Chor oder die Bläser einsetzen. Die Predigt des Pfarrers zur Heiligen Nacht war leider nicht genauso berührend. Anschließend gab´s den traditionellen Kartoffelsalat und die Wiener Würstchen und ein Haufen Lebkuchen und Dominosteine bei eben der Selben schönen Musik auf CD Tonträger.
23.12.2025 Adventszeit, schönste Zeit

22.12.2025 100 Jahre Walter Womacka
Anlässlich des 100. Geburtstag führt die Helle Panke e.V. vier Filme des bekannten und einflussreichen DDR Künstlers Walter Womacka´s auf. Der Maler und Künstler begegnete mir schon als Kind in der Ausgabe meines Leseschulbuches. Mit meinen Umzug 1993 nach Berlin begegnete mir Womacka vor allem im Großformat in Form des Mosaikfries am Haus des Lehrers. Obgleich der Künstler auf mein eigenes Künstlerleben keinen bewussten Einfluss nahm, fühlte ich mich ihm verbunden.
Während der Filmvorführung werde gezeigt: Bild aus hunderttausend Steinen (DEFA, 1959), Ein Fest für die Augen (Fernsehen der DDR, 1984), Verewigt (BR/MDR, 1994) und Farbe bekennen. Der Maler Walter Womacka (MDR, 2003). Darin sieht man den Künstler in seinem Atelier, bei der Gestaltung des Wandmosaiks Unser neues Leben, von 1959, Rathaus Eisenhüttenstadt, beim Spaziergang mit Enkel und Ehefrau u.a.
Schnell nehme ich ihn durch die Filmbeiträge als Arbeitsmaschine wahr. Neben seiner Tätigkeit als Rektor der Kunsthochschule Weissensee arbeitete er an seinem malerischen und grafischen Werk und Schuff zu dem noch die Gebäude gebundenen Monumentalwerke, die heute noch Stadtbilder in Ostdeutschland prägen.
Meine Kritik an seinem Werk gilt dem Umstand, dass er seine Handschrift immer mal änderte je nach Einflussnahme anderer Stile. So erkenn ich Picasso wie Kubisten bspw. in einigen seiner Arbeiten. Das mag engstirnig wirken, aber ich will dann doch Womacka sehen, wenn Womacka es geschaffen hat.

Links: https://www.defa-stiftung.de/filme/filme-suchen/walter-womacka/
Nachlese bei NDR Mediathek: Walter Womacka „Am Strand“ – Die Geschichte eines Gemäldes
19.12.2025 Zeughauskino
Im Dokumentarfilm Sperrmüll im Zeughauskino Berlin-Mitte begleitet die Regisseurin Helke Misselwitz vom Frühsommer 1989 und März 1990 den Ostberliner Jugendlichen Enrico. Er ist Mitglied der vierköpfigen Punkband „Sperrmüll“. Weggeworfene Utensilien nutzen sie als Schlagzeuge, die einen aggressiven, harten Sound machen. Die Texte der Songs schreibt Enrico selbst. Die Texte der Songs schreibt Enrico selbst. Der Zuschauer erfährt, dass er Musik machen will, und dass seine Mutter ihn dabei unterstützt. Sie selbst hatte früher eine Gesangslaufbahn vorgesehen, doch eine Schwangerschaft ließ diesen Traum in weite Ferne rücken. Die Kamera begleitet Enrico auch zu Demos und Protesten in der Gethsemanekirche, Berlin-Prenzlauer Berg, im Herbst 1989, sowie zur Volkskammerwahl der DDR am 18. März 1990.Während seine Mutter den Westberliner Heinz Richter Heiratet und mit der jüngeren Tochter nach Westberlin ausreist, bleibt Enrico der DDR verbunden. – Er bleibt, macht Musik. Schließt sich einer neuen Band an, nun als Gitarrist. Als die Mauer fällt, wünscht er sich, dass die DDR autonom bleibt.
Ich erkenne in seiner Suche nach Orientierung in dieser besonderen Zeit auch mich selbst.
Fazit: Daumen hoch.
15.12.2025 Atelier

14.12.2025 Bunkeranlage im Volkspark Humboldthain
Mein sonntäglicher Ausflug führt mich in den Volkspark Humboldthain, zur Hochbunkeranlage mit Flakturm. Ich mache einige Fotos von der Anlage mit meiner Spiegelreflexkamera. Ein Mann mit einem Teewagen verkauft Getränke. Außerdem läuft von seiner Musikanlage über Lautsprecher weihnachtliche Musik mit englischen Texten. Ich schwinge meinen Körper zu den verschiedenen Rhythmen und fühl mich wohl.
Die Lichtverhältnisse zum fotografieren sind mäßig. Die Motive werden zudem von den vorherrschenden Braun-Ocker-Grau-Grün Farbtönen der Parklandschaft verdunkelt.
P.S. Ich suche wie in der Malerei bei der Motivauswahl nach den Bild gestalteten Konturen, Kontrasten und Formen.

12.12.2025 VHS Kurs: Digitale Fotografie
Der VHS Workshop Digitale Fotografie bei Edith Maria Balk, der heute zu Ende ging, hat meinen Kenntnisstand sowie technische Fähigkeiten im Umgang mit meinen Kameras gefördert. Aber auch die Erkenntnis, dass noch viel Luft nach oben ist.
Das letzte Foto schoss ich im Kursraum.

11.12.2025 VHS Kurs: Digitale Fotografie

10.12.2025 Bergfest beim VHS Kurs
Die digitale Fotografie hat sich entzaubert durch die Nachahmung technischer Möglichkeiten.

9.12.2025 Digitale Fotografie
Vom 8. bis 12.12.2025 belege ich den Grundkurs für Digitale Fotografie, der VHS Berlin Friedrichshain-Kreuzberg, bei Edith Maria Balk. Der Kurs wird mich befähigen Einstellungen an meiner Kamera zu tätigen, die über die Einstellung Automatik hinaus gehen. Meiner Selbsteinschätzung nach, wo ich zu Beginn stehe, lege ich meinen Kenntnisstand auf einer Skala von 0 bis 10 auf 2 fest. Und die Einschätzung meines Kenntnisstandes nach Abschluss des Kurses auf 10. Heute korrigiere ich die 10 auf 4. Ich bin nicht sicher, ob ich die 4 wirklich am Freitag erreiche. Meine Kamera, eine Nikon-Spiegelreflexkamera für Fortgeschrittene macht 1,5 Tage nur schwarze Fotos, ehe sich Fortschritte in der Handhabung ergeben. Und die ebenfalls mitgenommene Sony Nex 7-Systemkamera ist mir in anderen Fragen rätselhaft.

6/7.12.2025 Zeichne auf dem WeihnachtsZauber am Gendarmenmarkt
Wie schon 2024 zeichne ich an der Kreidetafel auf dem WeihnachtsZauber am Gendarmenmarkt. Allerdings mit dem Unterschied, dass die Tafel viel kleiner ist und der Standort gegenüber der Bühne Besucher dazu anregt, sich direkt an die Tafel zu stellen – für einen guten Blick auf die Bühne. Gut, dass die Marktgäste entspannt auf meine Bitte, Platz zum Zeichnen zu lassen, ausnahmslos positiv reagieren.

2.12.2025 Neues Bild
Habe ein neues Bild begonnen. Über die Farbpalette bin ich mir noh nicht im klaren.

30.11.2025 Kunsthaus Minsk, Potsdam
Das Kunsthaus Minsk, Potsdam zeigt die interdisziplinären Gruppenausstellung Wohnkomplex. Kunst und Leben im Plattenbau. Der Kurator Kito Nedo widmet sich der Frage, wie die ostdeutschen Plattenbau-Siedlungen in der Kunst verhandelt werden. Präsentiert sind Werke, die seit den 1970er-Jahren bis in die Gegenwart entstanden. Die Architektur der PLATTE wird unterschiedlich hervorgehoben. Sybille Bergemann hat z.B. ein Wohnzimmer in einem Lichtenberger Häuserblocks fotografiert. Maßstab der Zimmer sind Baugleich. Sie unterscheiden sich lediglich durch die Raumgestaltung: Tapete, Inventar. Christians Thoelkes Gemälde Kaufhalle führt uns an der Nase. Es versprüht Ostcharme, ist aber laut Entstehungszeit des Bildes von den Spuren der Zeit der Wiedervereinigung längst gekennzeichnet. Markus Draper hat aus Plattenbau-Objekte in Optik eines Rohbaus aus Zinkguss der Ortschaften: Berlin-Marzahn, Neubrandenburg, Magdeburg, Schwedt und Senftenberg. Ihr Erscheinungsbild erinnerte mich an die entkernten Plattenbauten Frankfurt/Oder, die dem INSEK Stadtplanungskonzept Rückbau zum Opfer fielen und die mich zu der Arbeit Rückbau und Shrinking Cities – Rückbau inspirierten. Sabine Moritz 18-teilige Zeichenserie Lobeda, 1991/94 zeigten den Plattenbausiedlungen aus der Distanz. Gebäude, Wege, Rabatten u.a. werden angedeutet, die meisten Flächen aber bleiben weiß, nicht bezeichnet und leer. Gerade so viele Informationen, wie notwendig. Es gefällt mir.
Fazit: Sehendwerte Ausstellung.

29.11.2015 StarUp Vocals
Wohne dem Auftritt des StartUp Vocals auf dem Weihnachtsmarkt am Gendarmenmarkt bei. Ihr Repertoire reicht von Jazz und Pop. Ich komme in gute Adventszeitstimmung, auch durch die Gerüche der Glühwein- und Essensstände.

28.11.2025 Samurai Museum Berlin
Gemeinsam mit P. besuche ich die Tanzperformance-Aufführung des Kollektiv Elektro Kagura, im Samurai Museum Berlin. Das Tanzensemble verbindet Tanz, Theater, digitale Projektionen und elektronische Musik. Die Aufführung bezieht sich auf die Geistergeschichte der Zehn Teller von Okiku, einem Dienstmädchen, das zu Unrecht beschuldigt, gefoltert, ermordet und nun als rachsüchtiger Geist zurückkehrt. Eine Gruppe Tänzer, die mit Kimonos und mit japanischen Hüten bekleidet sind, tanzt im Tackt einer Trommel. Nach dem die „zu Ende getanzt“ und an den Seiten der Holztribüne zum liegen und ruhen kamen, steigt die Solistin Ichi-Go mit 10 Tellern aus einer auf der Bühne positionierten stabilen Holzkiste tanzperformativ heraus. Die Tänzergruppe rührt sich. Man vermischt sich, kämpft. Erst die Nachlese im Internet erzählt mir, welche Bilder getanzt wurden.
P.S. Das Museum selbst, dass wir Zuschauer durchliefen, um zur Bühne zu gelangen, bestand u.a. aus Vitrinen mit echt coolen Sachen, die ich von Martial-Arts-Filmen kenne. Sehr spannend, sehr außergewöhnlich.


23.11.2025 Wernigerode
Wie schon im vorigen Jahr, erlaube ich mir im November ein paar Tage Berlin den Rücken zu kehren. Diesmal verschlägt es mich in die Kurstadt Wernigerode, die von meiner Heimatstadt Nordhausen mit der Harzquerbahn seit Anno 1899 zu erreichen ist und mir on Kind an bekannt ist. Beim ersten Spaziergang durch die Stadt schwelge ich schnell in Erinnerungen und meine auch einige Fachwerkhäuser wieder zu erkennen. Im Café Burg komme ich mit der Inhaberin ins Gespräch, die ihr Frühstücksbrunch anpreist. Ich frage sie, ob es in der Stadt ein Café, in dem ein grüner Kachelofen im Winter die Gäste wärmte? Dort wärmte ich mich gern im Winter nach der Wanderung und verspeiste dabei den besten Zuckerkuchen meines Lebens. Nein, von so einem Café wüsste sie nichts, aber sie würde ihren Mann, den Bäcker bitten, am Mittwoch Zuckerkuchen zu backen.
P.S. Und schon hatte ich eine Urlaubsverpflichtung.
21.11.2025 Finissage GG3
Während der Finissage im Group Global 3000 – Galerie für nachhaltige Kunst ist ein Architekt auf meine Arbeit Herr Gaebler, benutzen Sie Sonnenschutz? aufmerksam geworden. Der Architekt arbeitet bei der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen, wo Christian Gaebler seit 2023 Senator ist. Mit der klmiaresilenten Sanierung des Genedarmenmarkt ist er auch nicht einverstanden. Klimaresilent, das sei das neue Unwort in seinen Kreisen.
Insgesamt ein guter Abend. Nach dem die Gäste gegangen waren, bauten die anwesenden Künstler ihre Exponate ab. Ich war 23 Uhr Zuhause mit meinen 20 Zeichnungen und dem Audio.

20.11.2025 Atelier
Male weiter an Bild mit Jungen, sitzend.
9.11.2025 Rosa Luxemburg
Das Kino Babylon präsentiert: Rosa Luxemburg (1986), unter der Regie von Margarethe von Trotta. Erzählt wird die Geschichte der deutsch-polnischen Sozialistin Rosa Luxemburg. Von Trotta besetzt Barabra Sukowa mit der Hauptrolle. Abgesehen von der Figur Luxemburg zeichnet der Film gleichzeitig ein eindringliches Bild der wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Situation dieser Umbruchszeit.
Im Anschluss an die Vorführung erklärte von Trotta, dass sie insgesamt zwei Jahre für die Vorbereitung verwendet habe. Allein ein Vierteljahr habe sie damit verbracht, rund 2500 Briefe Luxemburgs zu lesen, die sich in einem Archiv der DDR in Ost-Berlin befanden. Auf dieser Basis habe sie die Figur geformt.
Die Regisseurin zeigt einfühlsam ein Porträt der Sozilistin, die sowohl in ihrer politischen Arbeit wie als Privatperson unbestechlich ist.
Hervorzuheben, weil traumhaft ist die Regie und die Kameraführung. Ein Beispiel dafür Anfangsszene: Rosa geht spazieren. Es ist trist, kalt, kein Mensch weit und breit. Aber ein großer, schwarzer Rabe läuft neben ihr und weicht nicht von ihrer Seite. Wenn der Rabe in der Szene fehlte, was würde, wie würde Rosa Luxemburg in dieser Szene auf mich gewirkt haben?
Das Ende des Filmes stellt eindrücklich die politischen Kräfte dar, die ihren wie den Tod von Karl Liebknecht herbeiführen. Das Beide hinterrücks mit einem Gewehrkolben bewusstlos geschlagen worden, ehe man sie durch einen Revolverschuss ermordete. Die Rohheit der Täter und die Begleitumstände, die dazu führten waren schwer auszuhalten für mich.
Fazit: Unbedingt ansehen.

8.11.2025 Berliner Ensemble
Die Aufführung Future Macbeth, des Autoren- und Regie-Teams Pavlo Arie und Stas Zhyrkov, ist unter Mitwirkung von Schauspielstudenten der Berliner Hochschule für Schauspielkunst Ernst Busch, im Neuen Haus des Berliner Ensemble aufgeführt wurden. Das spartanische Bühnenbild ist mit einer Zimmerwandattrappe mit Tür und langgestreckter Fensterlade, drei Drehstühle und ein Sessel ausgestattet. Die Grundidee des Stücks steht in Anlehnung an Shakespeares Drama Macbeth, in der der schottische Heeresführer Macbeth, König Duncan tötet und sich selbst zum König von Schottland krönt. Die Inszenierung verzichtet darauf, Detailgetreu Shakespeares Stoff nachzuerzählen, führt aber die wichtigen Figuren: drei Hexen, König Duncan von Schottland, Lady Macbeth, Banquo, Mackie Teeth und die Hauptfigur Macbeth ein. Slapstick und tiefer greifende Szenen wechselten sich ab, in denen es um Macht, Gewalt und Tyrannei geht. Besonders gefiel mir Fabian Mair Mitterer als Macbeth, der Körper und Mimik stark neben der Sprechstimme einsetzte, wie ich es eigentlich nur von Stummfilmen kenne. Es wird mich nicht wundern, wenn DER noch richtig durch die Theaterdecke geht. Auch das Schauspiel des Elias Nuriel Kohl als König Duncan und Mackie Teeth gefiel mir sehr. Kritik gilt dagegen den Besetzungen der Hexen: Der Hexer Emil Kollmann war beim Schreien, Grölen nicht zu verstehen. Die Hexen-Darstellerinnen Eszter Demecs und Greta Geyer sind sich sowohl optisch wie stimmlich so ähnlich, was mich zur Frage bringt: Wieso braucht das Stück dann Zwei vom Selben? In meinen Augen, eine formale Fehlbesetzung.

4.11.2025 GG 3000 – Galerie für nachhaltige Kunst
Sitze meinen Galeriedienst im Global Group 3000 ab. Es kommen fünf Besucher während der Zeit. Einer davon, ein Mann, ist mir suspekt. Ich frage mich, ob er die Räume auskundschaftet?

3.11.2025 Atelier

2.11.2025 Zeughauskino
Das Zeughauskino präsentiert in der Reihe Zwischenzeit, Filme von Viola Stephan. In den 90er Jahren, einer Zeit des geopolitischen Wandels, trifft sie auf Menschen, die die Auswirkungen der Übergangsphase spüren. Es entstehen in 4 Ländern Filme. Der Dokumentationsfilm Ślask–Schlesien (OmU mit eng. UT), wurde in Niederschlesischen Dorf Milków/PL gedreht. Kameraeistellungen von einer Blaskapelle vom Steinkohletagebau, ein Frauenchor in und vor Kirche, 3 Frauen auf einem Hof, Arbeiter auf einem Hof an einem Tisch, Kumpel beim Duschen und Umkleiden, Untertage-Kumpel bei der Arbeit, Kamerafahrt mit Auto im Dorf, Umland und Betriebsflächen über Tage des Steinkohletagebaus. Die Kamera beobachtete die Menschen in diesem Dorf. Es gab keine offene Interviewsituation zwischen Filmer und gefilmten.
Wenn die Protagonisten sprachen, schwamm ich zuweilen, weil meine Translate-Fähigkeiten bei schnellem Sprechen nicht ausreichen. Brigitte Bardot, die darin besser ist, hatte leider auch Probleme gehabt mit dem „Alles verstehen“.
Fazit: Ich schätze den Film ist sehenswert. Polnisch/ englische Sprachkenntnisse sind von Vorteil.

31.10.2025 Vernissage VBK
Mit Brigitte Bardot war ich zur Kunstpreisausstellung der A und A Stiftung, in der Galerie VBK. Ich hatte mich nicht beworben, weshalb ich im Gegenteil zu anderen Anwesenden tiefen entspannt war. Es gab Frei-Getränke und zu Gratis-Häppchen. Ich lernte einen Stephan kennen, der bei boesner arbeitet und sich seinen eigenen Worten nach ein Fachmann für Papiersorten ist. Ich könne ihm Arbeitsproben mitbringen und er würde mir sagen, auf welchem Papier ich gezeichnet habe. Na dann: Ich werde den Mann beim Wort nehmen.

28.010.2025 Atelier
Im Hintergrund ist ein Bild, dass mir gestern bei meiner Aufräumaktion in die Hände gefallen ist. Die Anlage ist ausbaufähig. Ich male es weiter.

27.10.2025 Aufräumen im Atelier
Direkt an der Tür räume ich das Regalfach aus. Dabei entdecke ich drei Aktgemälde von Andrea und Frank, die in den Grundtönen Neapelgelb und böhmischem Grün gehalten sind. Außerdem finde ich ein Selbstporträt, ebenfalls in Neapelgelb sowie Blau-Lila. Alle in einem Format von 100 x 120 cm. Darüber hinaus ein Akt von Frank, das in Neapelgelb und Pink-Lila erstrahlt. Ein weiteres Gemälde zeigt einen stehenden weiblichen Akt in den Farben Rot-Orange und Neapelgelb, beide im Format 160 x 100 cm. Zudem gibt es ein Gemälde einer sitzenden Frau auf einer Decke, in den Grundtönen Neapelgelb und Krapplack, das im Format 100 x 120 cm gefertigt wurde. Alle diese Werke entstanden vor 2006.
Aber auch Arbeiten nach 2006 räume ich aus dem Regal. Ein 3-teiliges Bild von 2008 zeigt eine Untersicht einer Menschengruppe, ohne Köpfe ist darunter. Ich hatte in der Zeit von 2008-2010 einige Bilder so angelegt. Warum ich damit aufhörte und nur noch Draufsichten malte: Ich weiß es nicht.

25.10.2025 Live-Performance
Zum Abschluss der Ausstellung In Transition – From Performance to Exhibition besuche ich mit Freunden und Bekannten aus dem Norden Berlins die Ausstellung (Siehe auch 18.10.2025). Leider waren wir spät dran oder aber die Performer haben nicht lange performant, so dass wir lediglich der Performance von Peter Schlangenbader in Gänze beiwohnten. Wir widmeten uns den Ausstellungsexponate und führten Gespräche über das Gesehene und über andere kunstferne Gegebenheiten.

24.10.2025 Künstlergespräch im GG3
Im Projektraum Group Global 3000 – Galerie für nachhaltige Kunst nutze ich die Gelegenheit über meine 20-teilige Zeichenserie Herr Gaebler, benutzen Sie Sonnencreme? zu sprechen. Nach anfänglicher Aufregung bin ich ganz zufrieden mit meiner Performance, da es auch nach dem offiziellen Veranstaltungsteil noch zu interessanten Gesprächen mit Gästen und Künstlerkollegen kommt.

22. und 23.10.2025 Atelier

20.10.2025 Pleinair in Velten

18.10.2025 Performance und Animation/Visuals
Im Rahmen der Ausstellung In Transition – from Performance to Exhibition, Galerie VBK, wird das Performance-Programm Subkunst, Yukihiro Ikutani, Live Animation / Ichi-Gwo o, Tanz / Corinna Rosteck, Visuals (https://www.vbk-art.de/intransition/subkunst-yukihiro-ikutani) aufgeführt. Ich sitze in der ersten Reihe. Corinna Rosteck, Künstlerin und Kuratorin, führt durch den Abend. Erst singt AXL OTL, ein „weißer, hoch gewachsener Mann“, im Kimono auf dem Boden sitzend von 1500 Jahre alten Göttern, die meinem Eindruck nach, hauptsächlich Sex hatten und eine Unzahl Nachfahrens-Götter gebaren. Manche waren guter, andere böser Natur. AXL OTL – Komponist, Japanologe und Literaturwissenschaft für englische Sprache -, begleitet sich selbst auf einer Gitarre. Vor ihm liegt eine japanische Schriftrolle, aus der er auf japanisch singt. Per Beamer läuft zum Gesang ein Comic-Strip von Yukihiro Ikutani, der die Geschichte bebilderte. Zwischen den Programmpunkten der Video-Stil Lipuid light von Ina Klee, auf denen eine Schwimmerin, umgeben von Wasser, ihre Bahnen schwimmt. Die Kamera ist unter Wasser oder sie ist hinter Glas, weil die Schwimmerin sich in einem gläsernen Schwimmbecken befindet. Ich weiß es nicht. Von der schwimmenden Frau werde ich ins Becken gezogen: Die Vision von Unendlichkeit erhielt plötzlich eine realistische Gestalt. Anschließend tanzte die Tänzerin Ichi Go, nach der komponierten Musik von AXL OTL, Szenen aus einem Gesamtprogramm. Die zu beschreiben bin ich nicht in der Lage. Ihr Tanz – einzigartig. Ich bin sicher, sie ist ein Star in ihrer Klasse.
Link zur Companie von Ichi Go & Co: https://elektrokagura.com
17.11.2025 Charlotte (Comic) und Atelier
Treffe Charlotte in Neukölln bei Cappuccino und türkischer Linsensuppe. Wir schauen uns unser Comicprojekt an, dass wie im Mai begonnen hatten. Jede zeichnete ein Panel, dann zeichnete die Andere das Zweite und so weiter. Charlotte hat unsere kleine Geschichte über Maman, eine neun Meter große Spinnenskulptur der Künstlerin Louise Bourgeois, die u.a. vor der Tate Modern, in London/GB steht, mitgebracht und ausgebreitet. Wir sprechen über einzelne Panels. Ich erfreue mich nochmal an der ausdrucksstarken Farbigkeit und der simpel gezeichneten Figuren. Für uns beide geht die Reise mit dem Comiczeichnen nicht weiter. – Aus unterschiedlichen Gründen. Wir wollen uns beim Theaterworkshop im Berliner Ensemble zusammen einfinden. Charlotte hat bereits langjährige Erfahrungen im Kabarett, Improvisationstheater und als Puppenspielerin.
Im Anschluss begebe ich mich ins Atelier, wo ich ausschließlich an dem Bild mit Junge am Strand weiter male.

13.11.2025 Künstler protestieren
Mit Brigitte Bardot treffe ich pünktlich am Berliner Abgeordnetenhaus ein. Abermals protestieren wir gegen die Kürzungen des Haushalts für Kultur und Soziales. Staatssekretärin Cerstin Richter-Kotowski der Senatsverwaltung für Kultur und Gesellschaftlichen Zusammenhalt empfängt uns trotz Terminankündigung am 1.10.2025 nicht in „ihrem Haus“, um unsere Petition #SOS#SaveOurStudiosBerlin in ausgedruckter Form – mit allen Unterschriften auf 25 Metter Rolle – entgegen zu nehmen. Auch die Vertretung lässt uns nicht ins Haus.Ein Abgeordneter der Grünen kam vor die Absperrung des Abgeordnetenhauses und nahm die Petition letztlich entgegen.
Das im Videoclip zuhörende laute „SOS“ ist aus meinem Hals gekommen. Es hat mich
echt high gemacht, als hätt` ich mir etwas eingeworfen.
Auch der rbb hat darüber berichtet.
11.10.2025 Atelier
Ich male an dem Bild mit sitzendem Jungen mit Kapuzenjacke. Ich beschäftige mich vorwiegend mit der Farbpalette des Hintergrunds und der Kleidung des Jungen. Noch ist nichts entschieden.

10.10.2025 Vernissage für Herrn Gaebler
Tom Albrecht, Künstler und Gründer der Galerie GG3, begrüßt die zahlreichen Gäste. In seinem Rücken strotzt Herr Gaebler, benutzen Sie Sonnencreme? freudig wegen seiner erneuten kurzfristigen Präsenz in einer Galerie. Der Künstler Stephan Groß übernimmt das Wort und hält die Einführungsrede. Die fünf Kuratoren der Galerie und Ausstellung präsentieren eine stumme Performance: Es wird ohne Ankündigung im Raum dunkel. Dann, Auftritt der Performer. Alle tragen Masken. Ehe ich mich noch fragen kann, was ich sehe, wird das Licht angeschaltet. Das Publikum beginnt zu Klatschen. Ich auch, aus Höflichkeit. Ich komme mit verschiedenen, auch mir unbekannten Gästen ins Gespräch. Mit Dr. René Knorr, der demnächst Führungen mit Schulklassen in der Galerie durchführen wird, spreche ich am längsten. Er will wissen, was meine Arbeit mit dem Thema Klimakommunikation zu tun hat? Wir sprechen über Sehgewohnheiten, über Auffassungen zur Kunst. Er erzählt mir, dass seine Großeltern ein schönes Bild bei sich hängen hatten, unter dass er sich gern legte. – Dass ihn zum Träumen anregte. – Halb elf brach ich auf. Es war ein langer Tag.

9.10.2025 Ausstellungsaufbau, Galerieaufsicht, Ateliertreffen
Von 10:30 bis 13:30 Uhr installiere ich die 20 gezeichneten Segmente meiner Serie Herr Gaebler, benutzen Sie Sonnencreme?, inclusive Audio mit Player und Kopfhörer im Raum von Group Globel 3000 – Galerie für nachhaltige Kunst.

Anschließend fuhr ich in die Galerie VBK, wo ich heute Aufsicht für die Show In Transition from Performance to Exhibition hatte. Dylan Scott, Archiv-Mitarbeiter des Vereins, half mir Gott sei Dank dabei, die zahlreichen technischen Geräte zum Laufen zu bringen. Es kamen nur wenige Besucher, was mich nicht verwunderte, da keine Live-Performance stattfand wie zur Vernissage.
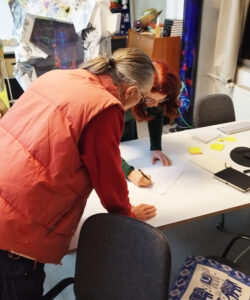
18 Uhr, nach Galeriedienstende holte mich Brigitte Bardot ab. Sie fuhr mich ins Atelierhaus, wo ein Treffen mit den Kollegen stattfand. Thema war wieder mal: Was können wir für den Erhalt des Berliner Atelierförderprogramms tun?
5.11.2025 We are closing
Nach 20 Jahren schließt das Buchstabenmuseum seine Türen, dass sich im Stadtbahnbogen im Berliner Hansaviertel befindet. In der taz heißt es: „…Wir (sind) an einem Punkt (angekommen), wo es ohne finanzielle Unterstützung einfach nicht mehr geht.“, erklärt Gründerin und Leiterin Barbara Dechant der taz-Reporter Andrea Hergeth. Das Museum hat typografische Objekte aus dem öffentlichen Raum gesammelt, bewahrt, dokumentiert und dauerhaft ausgestellt. Lange nicht, endende Warteschlangen blockieren den Eingang. Bedauerlich, dass wir erst durch die Schließungsankündigung auf das Museum aufmerksam geworden sind. Mit weniger Besucher in den Ausstellungsräumen, hätten wir noch mehr entdeckt.

4.10.2025 Vernissage
Punkt 17 Uhr beginnt die Vernissage In Transition from Performance to Exhibition, in der Galerie VBK. Nancy ist extra wegen der Vernissage angereist aus Niedersachsen. Sie erfreut sich an den zahlreichen Performance, die an diesem Abend vorgeführt von verschiedenen Darstellern werden . Mein Ausstellungsbeitrag Die Zuwanderin: Das Tun läuft über einen Monitor. Der Ton wird über einen Kopfhörer empfangen, nur an diesem Abend nicht. Die Geräuschkulisse verschluckt jeden Ton. Am Ende zählt man 300 Gäste.

3.10.2025 Preview
Preview der Ausstellung In Transition from Performance to Exhibition, bei der ich mit der Filmdokumentation Zuwanderer: Das Tun, von Wilda Wahnwitz beteiligt bin. Es wurde der Film Transit von Angela Zumpe vorgeführt. Zumpe begibt sich darin auf die Spuren ihres Bruders, der mit 21 Jahren von der BRD, in die DDR auszog. Zumpe selbst ist damals 13 Jahre alt. Der Film ist schwierig für mich. Zumpe selbst war nicht anwesend.
P.S. Zwischen 20-30 Gäste waren inclusive der beteiligten Künstler anwesend.

1.10.2025 Protest vor dem Abgeordnetenhaus
Am Berliner Abgeordnetenhaus wird erneut gegen Kürzungen des Haushalts für Kultur und Soziales protestiert. Ich habe mich auf Krücken mit der BVG in Stellung gebracht mit Gleichgesinnten. Auch Brigitte Bardot unterstützt unseren Protest. Halb eins etwa werden wir in Haus gebeten. Cerstin Richter-Kotowski, Staatssekretärin der Senatsverwaltung für Kultur und Gesellschaftlichen Zusammenhalt (seit Juni 2025), empfängt uns im Treppenhaus. In einem Kreis um sie herum hören wir ihr zumeist zu. Sie erklärt, dass sie den Bestand an Ateliers von bis zu 2000 Arbeitsräumen erhalten wollen. Neue stellt sie nicht in Aussicht. Verpflichtungsermächtigungen erteilt der Senat nicht, was heißt, das der Senat sich aus seiner bisherigen Position herauszieht. Es bleibt schwammig, ohne jegliche Zusage. Zum Abschluss übergeben wir unsere Petition, die rd. 6500 Unterschriften zählte. Wie kündigten an, dass wir am 13.10.2025 wieder kommen. Abermals mit der Petition im Gepäck. Wir besuchten noch die Tribüne. Im Plenarsaal wurden wir zur Kenntnis genommen. Man ermahnte uns, das wir nicht zu stören haben. Fotos, Rufe, Plakate, nichts sei erlaubt. Da es zu dem Zeitpunkt unserer Anwesenheit nicht um Themen ging, die mit unserem Protest zu tun hatten, blieben wir nur eine halbe Stunde.


30.09.2025 Atelier
Ich male und stecke mit dem neuesten Werk noch voll in den Anfängen. Nach dem ich die großen Formen definierte, suche ich jetzt das Farbpalette, die es halten kann.

28.09.2025 Open Studios
Von 15 bis 20 Uhr, öffnet das Atelierhaus Schön13 seine Türen für Open Studios. Ich zeige Malerei und einige Freilicht-Zeichnungen. Ich bin recht zufrieden mit der Auswahl meiner Werke. Viele der Besucher kamen durch einen Artikel in der Morgenpost.
Link: https://atelierhausschön13.de


27.09.2024 ProtestFest auf dem Steinplatz, Berlin-Charlottenburg und Atelier
Unter dem Motto: Gemeinsam setzen wir ein Zeichen gegen Kürzungen in Kunst, Kultur und Sozialem!, ruft der BBK Berlin auf zu protestieren.
Mit dabei sind Berliner Kunsthochschulen, Kulturinstitutionen, freie Künstler*innen und Sozialverbände.
Starke Rede zum Abbau der Atelierförderung durch den Senat, von Frauke Boggasch, Künstlerin und Sprecherin des BBK Berlin:
https://www.youtube.com/shorts/r9YQ9x9dNak?feature=share
.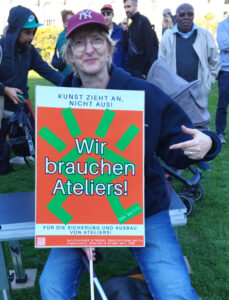
Anschließend fuhr ich ins Atelier, um für die Open Studios am Folgetag das Atelier herzurichten. Unser Atelierhaus Politiker hatte dazu eingeladen.

24.09.2025 Ahrenshoop/Darß
Schon wieder Darß: Diesmal bin ich direkt in Ahrenshoop untergekommen, direkt in Strandnähe. Ich zeichne meist am Strand, auch häufig Strand mit Strandkörben.

19.09.2025 Zeughauskino
Das Zeughauskino präsentiert eine Buchvorstellung und Filmeinführung: Thomas Helbig und Fabian Schmidt, der Reihe Nach Shoah. Die Autoren haben Bücher zu den Filmen Westernbork, 1944 und Historie(s) du cinéma, Episode 4B: Les signes parmi mous geschrieben. Mit Form des (Ge)denkens war der Abend übertitelt. Westernbork war ein niederländisch verwaltetes Judendurchgangslager, unter direkter deutscher Verwaltung der SS. Der Film bildet verschiedene Szenen im Lager ab, die z.T für den Film. inszeniert sein dürften. Der tonlose und kommentarlose s/w Film wurde schnell zu einer Aufmerksamkeitsgeduldübungen, da die Kamerabilder ebenfalls wenig abwechslungsreiche Motive boten. Das gesamte Dokument ging 2,5 Stunden, erklärte der Autor. Die Aufnahmen des Dokuments werden nach dem Krieg in verschiedenen Werken verwendet. Der Film ist in Gänze auch kostenfrei im Internet verfügbar.
Thomas Helbigs Buch beschäftigt sich mit einer der acht Videos der Serie Histoire(s) du cinéma, des Regisseurs Jean-Luc Godard, der zig laufende und statische Bilder zusammenfügte, Schriftbilder hinein montierte. – Selbst auch den Film mit Texten unterlegte. Es ist für den Einen interessant in seine Welt einzutauchen. Für mich nicht.
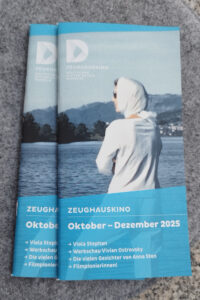
18.09.2025 Atelier
Habe an dem Bild mit sitzendem Jungen weiter gemalt. Währenddessen hörte ich das Hörbuch Die Stadt der Engel, von Christa Wolf, dass die Autorin selbst liest. Es handelt sich um eine autobiografische Prosa. Mich interessieren heute die Passagen besonders, in denen sich Wolf auf die USA bezieht. Da sind Entwicklungsvorgänge beschrieben, die sich heute in Great Amerika auf gräuliche Weise abbilden.
17.09.2025 Komische Oper
Ich war mit Brigitte Bardot bei der Generalprobe der (Rock) Oper Jesus Christus Superstar, von Andrew Lloyd Webber. Regie führte der mir unbekannte Andreas Homoki. Die Aufführung war für den Hanger, Flughafenfeld Tempelhof, konzipiert. Bis zu 500 Darsteller, darunter 350 Laiendarsteller waren geboten, um die Passionsgeschichte Jesus Christus zu erzählen. Die Aufführung selbst habe ich im Rollstuhl sitzend verbracht, da ich auf den Stühlen nicht sitzen konnte. Große Schmerzen hatte, da die Knieorthese, die ich zur Zeit tragen muss, auf dem Sitz auflag, drückte und starke Schmerzen verursachte. Ich fragte nach einer Alternative beim Personal. Der vierte Mitarbeiter setzte mich in einen Rollstuhl vor die Zuschauerreihen. Yaeh.
Die Aufführung war so lala. Es gab Höhepunkte, sobald Maria Magdalena, dargestellt von Ilay Bal Arslan oder Jörn-Felix Alt als Herodes sang. Insgesamt war es mir zu flach. Die Choreografie der Laiendarsteller und Tänzer sogar ermüdend. Viel Tamm Tamm und nix dahinter. Vermutlich ist auch die Musik mir zu gefällig, als dass ich das Musikwerk nicht in so einem Haus wie die Komische Oper sehen möchte. Passt doch besser auf den Ku`damm.
Fazit: Kein Weiterempfehlen.

14.09.2025 Tag des Denkmals
Besuch des unter Denkmal stehenden Staatsratsgebäude der DDR, am Schlossplatz 1, Berlin-Mitte, am Tag des Denkmals. Mit Nancy nehme ich an einer Führung durch das ehemalige Staatsratsgebäude teil. – Heutiger Sitz der Privaten Hochschule European School of Management and Technology (ESMT). Molly Ihlbrock, Leiterin der Unternehmenskommunikation, führt uns durch das geschichtsträchtige Haus, dass ich erstmals am 8.09.2019 (siehe Blogeintrag) besuchte. Vorlesungs-, Fest- und Bankettsäle, elegante Empfangsbereiche und Seminarräume – wurden auf zwei Etagen besichtigt. Frau Ihlbrocks Führung war insgesamt unbefriedigend, was auch andere aus der Gruppe so empfanden. Die Geschichte des Gebäudes vor dem Einzug des ESMT war ihr unzureichend bekannt. Über das ESMT wusste sie mehr zu sagen. Zum Beispiel, das unter Altkanzler Gerhard Schröder das ESMT laut einem Erbschaftsvertrag das Gebäude nebst Garten für 125 Jahr nutzen kann. Das ESMT ist laut Vertrag verpflichtet das Gebäude denkmalgerecht zu sanieren und zu pflegen. Bei näherer Betrachtung ist die Einhaltung der Denkmalgerechten Sanierung und Nutzung sehr zu Gunsten der ESMT gestaltet wurden, unter Zustimmung des Landesdenkmalamt Berlin. Zu sehen am Bespiel der großen Vorlesungsräume, die durch eine Trennwand geteilt wurden. Zwar ist die Zwischenwand innerhalb von 24 Stunden zu entfernen, aber welcher Umstand muss eintreten, damit die Stadt Berlin gebietet, dass die ESMT die Wand zurück baut? – Ein Regierungswechsel etwa?
Das ESMT bildet Wirtschaft-Eliten aus. Es ist ein surrealer, ideologischer Nutzungswandel vollzogen wurden mit dem Einzug der ESMT. Es schmeckt mir bitter im Mund.

13.09.2025 7Seen Havelfahrt
Nancy ist zu Besuch. Wir machen die 7Seen Havelfahrt, ab Lindenufer, Berlin-Spandau. Die Anreise ist für mich etwas beschwerlich, aber auf dem Schiff selbst ist dann genug Zeit mein Knie „zu beruhigen“.
Auf der 3,5 stündigen Schiffstour gibt es einiges zu sehen. Neben historischer Uferbebauung und dem Schiffsfahrtgebiet am Südhafen Spandau, schaue ich „gefühlt“ jedem Segelboot nach. Auch @emmaernsteinwand widmet ihnen besondere Aufmerksamkeit. In mein persönlichen Aufzeichnungen werde ich notieren: Wir sind beide Seebären.

11.09.2025 Galeriedienst
Mit Rosika Janko Glage verrichte ich meinen dreistündigen Galeriedienst. Brigitte Bardot fährt mich hin und holt mich ab wegen meiner immer noch bestehenden Gehbehinderung nach einem Unfall. Da sie eh da ist, schaut sie sich die Ausstellung Dialog der Zeiten an. Sie lobt die Ausstellungsstruktur und macht sogar einen Eintrag ins Gästebuch.

10.09.2025 Straußberger Platz
Erst Eis essen am Straußberger Platz. Dann zeichne ich ein Eckhaus des Platzes, von der Karl-Marx-Allee aus.

8.09.2025 Nach Shoah – Moderne Dokumentarfilme über die Zeit des Nationalsozialismus
Brigitte Bardot und ich schauen im Zeughauskino uns den Dokumentarfilm Was bleibt, von in der Regie von Gesa Knolle, Birthe Templin an.
Die Regisseurinnen interviewen Dietlinde, die in einem Lebensbornheim als Tochter einer Aufseherin des Konzentrationslagers Ravensbrück geboren wurde. Sie wuchs bei ihrer Tante auf, die ihr Adoptivkind körperlich misshandelte. Erst später erfährt Dietlinde von der Täterschaft ihrer Mutter als KZ-Aufseherin. Sie wirft ihrer Mutter nicht ihre NS-Vergangenheit vor bis sie Akteneinsicht in ihre Täterakte hat. Demnach hat ihre Mutter Häftlinge gequält, gefoltert und womöglich getötet. Das kann sie nicht weg reden, nicht verzeihen. Dietlinde bekommt Depressionen und nimmt professionelle Hilfe in Anspruch. Während sie sich mit der Familiengeschichte auseinandersetzt, redet sich ihre Tochter um Kopf und Kragen, sie hätte nichts mit der Vergangenheit ihrer Oma zu tun. Schließlich habe sie die nicht gekannt. Nur die Stief-Oma, und gegen die kann sie nichts sagen. Die war immer gut „zu mir“. Die hat „mir nie was getan“. Fotos werden von Dietlindes Mutter ins Kamerabild eingeführt, die sie in Uniform, auch mit einem ihrer zwei Schäferhunde zeigte. Auf einem Foto ist Dietlindes Mutter und ihre Schwester im Schwedt-See zu sehen. Sie baden direkt vor den Türen des KZs. Neben dieser (Täter)-Familie erhält die Jüdin Erna de Vries, Holocaust-Überlebende, ihre Tochter und Enkelin eine Stimme. De Vries ist 1943 mit ihrer Mutter zusammen vom Wohnort Kaiserslautern über Saarbrücken ins KZ Ausschwitz-Birkenau deportiert wurden. Sie arbeiteten in einem Außenlager, bis Erna krank wurde und einem Todesblock zugewiesen wurde. Ernas Erzählung nach hatte sie einen SS-Aufseher gebeten, es zu gestatten, dass sie sich von ihrer Mutter verabschieden kann. Dieser lehnte ab. Es ist ihr dennoch gelungen. Die Frauen treffen sich in einem der Lagergänge, im Wissen, dass sie sich nie wiedersehen. Im Film geht Erna nicht darauf ein, wodurch sie überlebt. Nur das ihre Mutter in Ausschwitz stirbt. Ernas Tochter erzählt davon, dass sie mit den Erfahrungen Ihrer Mutter und auch die ihres Vaters, der ebenfalls Holocaust-Opfer war, schon in ihrer Kindheit in Berührung kam. Die Eltern hätten zwar noch nicht direkt von den Demütigungen, Ängsten, Quälereien usw. erzählt, aber ihren Gesprächen war zu entnehmen, das die Zeiten einmal anders waren. – Dass man Bspw. kein Essen hatte. Obwohl sie einerseits eine sehr schöne Kindheit hatte, saß die Vergangenheit ihrer Eltern immer mit ihnen am Tisch. Sie kommt zu dem Fazit, das ihre Mutter selbst eine sehr glückliche Kindheit verlebte, die sie stark und optimistisch machte, so dass sie trotz dieser unsagbar tragischen Erfahrungen, nie aufgehört hat, das Leben zu lieben. Ernas Tochter habe einerseits eine glückliche Kindheit verlebt, aber durch die Familiengeschichte ihrer Eltern, habe ihre Kindheit auch gewisse Schwere. – Sie ist sich sicher, über die „Leichtigkeit ihrer Mutter“ verfüge sie nicht. Auch ist sie nicht begierig darauf, soviel und offen über die schlimmen Erfahrungen zu reden. Ganz anders dagegen ihre Tochter, also Ernas Enkelin, die alles Wissen will. – Jeden Pups, jede Kleinigkeit über Ernas Leben. Die auch Ernas Vorträge, in denen sie über die Holocaust-Erfahrungen spricht, begleitet.
Im nachfolgenden Gespräch mit der Regisseurin Birthe Templin, die in Norddeutschland und Argentinien aufwuchs, erfuhren wir, dass ihr Großvater bei der SS war und an Massakern in Italien beteiligt war. Ich dachte gleich, dass sie hiermit eine Art Stellvertreterfilm drehte, da diese über ihre Vergangenheit zutiefst verschweigt, wie diese zu reflektieren. Templin verwies darauf, das vor 1945 sich viele Juden dort ansiedelten. Ab 1945 viele Nationalsozialisten ins Land kamen. Da es nur eine jüdische Schule gab, gingen die Juden und die Nationalsozialisten Kinder zusammen in eine Schule bis den Erwachsenen aufging, dass sich das mit ihrer Vergangenheit nicht vereinbarte. Daraufhin bauten die Nationalsozialisten eine eigene Schule. In ihren Erinnerungen kam es nicht zu Übergriffen, zumindest hatte Templin nichts davon mitbekommen. Es gab Verbote, das ja, wie dass sie mit dem und dem nicht mehr spielen durfte. Ihre Eltern zogen sich nach und nach aus dem Umfeld der nationalsozialistischen Gesinnungsleute zurück. Templin erzählte noch, dass es ein Interview mit einer anderen KZ-Aufseherin geführt hatte. Diese wurde nach dem Krieg zu einer Haftstrafe verurteilt. Auf die Frage, was sie als das Schlimmste ihrer Erfahrungen nach der NS-Zeit betrachte, antwortete sie: Dass ich in einer Koje ihrer jüdischen Häftlinge schlafen musste. Das Interview wurde durch den Sohn verhindert. Inzwischen ist die Interviewte verstorben, dadurch gibt es neue Möglichkeiten fügt sie an.
Link: https://de.wikipedia.org/wiki/Erna_de_Vries
Link: https://www.dhm.de/zeughauskino/vorfuehrung/was-bleibt-13279/
7.09.2025 Tschoban Fondation – Museum für Architekturzeichnung
Gemeinsam mit Brigitte Bardot besuche ich die Schau Pläne und Träume – Gezeichnet in der DDR, in der Tschoban Fondation – Museum für Architekturzeichnung. Professionelle Zeichnungen für konkrete Bauaufgaben stehen neben privaten Zeichenblättern, die nach der Arbeit zuweilen auch fern jeglicher technischen Realitätsvermögens gestaltet großartige Visionen beinhalten: hier Auftragsbilder, da Wunschproduktion! Über 140 Zeichnungen wurden auf zwei Etagen aus Beständen öffentlicher Sammlungen, Archive und Privatbesitz präsentiert.
Das Museum ist ein viergeschossiger Massivbau mit gläsernem Staffelgeschoss und wurde vom Moskauer Büro SPEECH Tchoban & Kuznetsov entworfen. Die geschlossene Fassade ist mit architektonischen Skizzen in Reliefform dekoriert. Die Fassade verweist damit direkt auf seinen Nutzungszweck. – Zeichnung, Zeichnung, Zeichnung. Ich mag das Gebäude sehr und werde sicherlich nicht das letzte mal dort eine Ausstellung besucht haben.

5.09.2025 Vernissage
Die Vernissage Dialog der Zeiten, in der Galerie VBK, war gut besucht. Mit Gerd Logemann, Architekt und Künstler habe ich mich ausführlich unterhalten. Sein beruflicher Hintergrund und meine Arbeit über die Architektur, über die Geschichte und über die Nutzungsform des Gendarmenmarkt boten allerlei Gesprächsstoff. Während unseres Gesprächs trat der Bildhauer Robert Schmidt-Matt an mich heran und fragte, ob ich gehört habe, dass an heißen Tagen ein Spiegelei auf der Steinwüste des Gendarmenmarkts gebraten worden sei (laut CDU-Politiker Armin Laschet, Berliner Zeitung vom 16.03.2025). Ich verneinte. In späteren Recherchen hieß es, die rbb-Reporterin Olga Patlan habe bei gemessenen 52 Grad Celsius Bodentemperatur einen Bratversuch unternommen – jedoch ohne Erfolg. Das Internet behauptet, Eier würden bei 62 Grad Celsius stocken. Link: https://www.rbb24.de/panorama/beitrag/av24/video-berlin-hitze-ei-braten-sonne-heiss.html

3.09.2025 Ausstellungsaufbau
@emmaernsteinwand hilft mir beim Aufbau meiner 17-teiligen Zeichenserie Herr Gaebler, benutzen Sie Sonnenschutz?, die aus Bleistiftzeichnungen auf Kapa besteht. Alle Teile sind lediglich durch tesa Powerstrips miteinander verbunden. Für den ganzen Aufbau benötige ich etwa drei Stunden. Echt lang. – Kaum zu glauben.
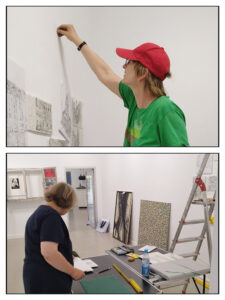
1.09.2025 Natur
Struktur, Farbe, Form: Die Natur bietet mir als Künstlerin die besten Vorlagen.

31.08.2025 Badetag, Darß
Heute ist Badetag am Weststrand. Ich war schwimmen. Um ins Wasser zu kommen, brauchte ich ewig. Gezeichnet hatte ich auch. Was: Wasser, Sand, Strandzelte.

30.08.2025 Prerow, Darß
Heute am Strandabschnitt 36 von Prerow mit den Dinos gewesen, die ich für einen neuen Dino-Film vorsorglich mitnahm an den Darß. Noch ist es nur eine Idee für einen kleine Videoclip. Mal sehen was daraus wird.

28.08.2025 Zingst
Besuche das Ostseeheilbad Zingst, das etwa 20 Autofahrminuten von meinem Ferienort entfernt ist. Dort kam ich an einen Schaukasten mit Plakat Pittiplatsch dem Lieben und seinen Freunden vorbei. Pittiplatsch gehörte zu den Vorbilder meiner Kindheit. Klar, dass ich mich mit seinem Abbild ablichten ließ.
Zu den weiteren Attraktionen zählte für mich die Leckbar, in der Klosterstraße 14, wo ich das Beste DDR-Softeis meines ganzen Lebens aß. Es war so gut, dass ich gleich eine zweite Portion kaufte.
P.S. Ansonsten ist Zingst nicht so mein Fall. Es ist mir einfach zu städtisch.

27.08.2025 Ahrenshoop, Strandzugang Bungalowsiedlung Krull
Auch dieses Jahr (siehe auch Blogeintrag vom 20.08.2024 ) suche ich die Nähe der Radaranlage der NVA auf, die unweit des Strandzugangs Bungalowsiedlung Krull, Ahrenshoop teils im Wasser, teils auf der Abbruchkannte der Steilküste liegt. Beim Warnschild vor Lebensgefahr gehe ich nicht weiter, zeichne. Einige Spaziergänger gehen an mir vorbei in Richtung der Anlage. Kommt zurück und zeigt mir Fotos der Anlage aus der Nähe. Hoch, also nach oben an der herunterstürzenden letzten der drei Anlagen könne man im Gegensatz zu vorigem Jahr derzeit nicht rauf klettern. Es sei zu steil.

26.08.2025 Zeichne
Heute zeichne u.a. ich in Wieck. Es finden sich hier Reetdach gedeckte Wohnhäuser. Nicht wenige davon sind Feriengasthäuser und im Stile ihrer historischen Vorbilder erbaut. Der Wohnkomfort ist darin standardisiert und unseren aktuellen Ansprüchen angepasst. Auch ich bewohne eines dieser Häuser.
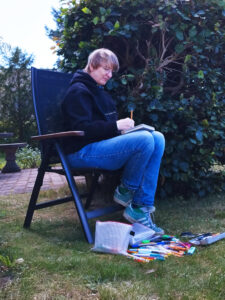
24.08.2025 Darß
Wie schon im vorigem Jahr verbringe ich etwas Zeit auf dem Darß. Durch meinen Unfall vor 2 Wochen ist meine Mobilität zwar eingeschränkt, aber, ach, Ostsee geht immer.

23.08.2025
Die Bundesregierung öffnet die Türen ihrer Ministerien. Mit Brigitte Bardot besuchte ich das Justizministerium und das Auswärtigen Amt, die beide fußläufig vom Hausvogtei Platz liegen. Wir durchliefen in jedem Haus Sicherheitskontrollen. Selbst meine Krücken machten eine Transportbandfahrt und wurden durchleuchtet. In den Foyers standen verschiedenste Informationsstände, die ausnahmslos mit zugewandten Vertretern ihrer Arbeitgeber besetzt waren. An vielen Informationsständen wurde man animiert, ein Quiz zu machen, dem wir gelegentlich folgten. Es gab sehr viele Hilfestellungen. Die Veranstalter wirkten darauf bedacht, Wissen über ihre Arbeit zu vermitteln, statt jemanden vorzuführen, der vermeintliche Wissenslücken hat. Die Veranstalter wirkten darauf bedacht, Wissen über ihre Arbeit zu vermitteln, als jemanden vorzuführen. Wer sich beteiligte, kannte sich mit Merchandising-Artikel beglücken. Wir sind mit Honig, Kugelschreiber, Notizblöcke, Trillerpfeife, Waffel, einigen Broschüren zufrieden abgetreten.
Fazit: Im nächsten Jahr gern wieder, aber mit mehr Zeit dafür einplanen.
Nicht positiv ist die Architektur des Erweiterungsbaus des Auswärtigen Amts aus dem Jahr 1999, entworfen von Thomas Müller und Ivan Reimann. Zeitgleich entstanden auch die Regierungsgebäude, die ähnliche stilistische Merkmale aufweisen dürften: Lichthof, hohe Stelen, strukturierte Glasfassaden und Fenster.

22.08.2025 Zeughauskino
Das Zeughauskino zeigt die Filmreihe: Dokumentarische Positionen: Rainer Komers. Komers ist Kameramann und Regisseur.
In 480 Tonnen bis Viertel vor zehn (1981, WDR) begleitet er im Direct Cinema-Stil Arbeiter am Südhafen von Duisburg-Hochfeld mit einer selbst geführten Kamera. Grobkörnige Schwarzweißbilder zeigen Geselligkeit, harte Arbeit, zunehmende Technisierung und Ungerechtigkeiten der Fachkräfte aus der Zeit als Hilfsarbeiter.
In Ruhr Record (2014) verzichtet aufs Gesprochene und setzt auf eine Sinfonie aus Klang und Rhythmus, die den regionalen Alltag fotografisch in Szene setzt. Sie zeigt einen querschnittartigen Alltag: Pferderennbahn neben Wagenplatz, Kleingarten neben Hochofen, Stadtautobahn neben Gartenteich, Zechenschließungen neben Hightech-Fabrikation.
Fazit: Komers beschreibt sich selbst als beobachtenden Dokumentaristen, der lediglich die Kamera drauf hält auf sein Sujet. Sowas kann gelingen, in seinem Fall, nein. Ich habe mich über lange Strecken gelangweilt.

17.08.2025 Berlin Biennale für zeitgenössische Kunst
Heute zweiter Ausflug der Biennale Berlin. Diesmal besuchen wir das KW in der Auguststraße 69. Brigitte Bardot, Sandra und Yvonne sind wieder an Bord. Vorab, die Architektur, innen wie außen, mag ich nicht. Große Aufmerksamkeit schenkte ich dem Mega-BH El Corpiño, von 1995/2025, das aus Argentinien stammende Künstlerin Kikí Roca als Mitglied des Kollektivs Las Chicas del Chancho y el Corpiño gestaltete. So einen großen BH hatte ich mein Lebtag nicht gesehen. Die Arbeit steht in Zusammenhang mit der argentinischen Militärdiktatur-Rhetorik, mit dem Morde an politischen Gegner*innen verschleiert werden sollten. Die ironische Reaktion der Künstlerinnen auf eine maskulinistische Äußerung des Provinzgouverneurs (“… müssen wir ihr die Krise die Brust bieten …”) kritisiert den korruptionsbedingten wirtschaftlichen Niedergang und fordert Gerechtigkeit durch die Mütter und Großmütter der Verschwundenen auf der Plaza de Mayo in Buenos Aires.

16.08.2025 Käthe, Pey Bau, Zeughauskino
Auf dem Weg zum Pey-Bau – Deutsches Historisches Museum, der das Zeughauskino derzeit beherbergt, sag ich Käthe „Hallo“, die ich in Form der Pietá-Plastik in der Neuen Wache antreffe.

Anschließend geh ich zum Pey-Bau, warte darauf, dass die Kasse des Zeughauskino öffnet. Auf einem Baugerüst nehme ich Platz und zeichne den modernen Gebäudeteil des Historischen Museums.

Im Abendprogramm des Zeughauskino wird der deutsche Film Die Sünderin, 1950, in der Regie von Willi Forst vorgeführt. In den Hauptrollen Hildegard Knef, in der Rolle der Prostituierten Marina und des Kunstmalers Alexander, besetzt mit Gustav Fröhlich.
Marina`s Stimme aus dem Off erzählt die triste Geschichte ihres Lebens, die nach einem umfangreichen Rückblick zur Anfangsszene zurückkehrt. Schon früh lernt Marina am Beispiel ihrer Mutter, das es sich lohnt mit lukrativ betuchten Herren zusammen zu tun. Marina selbst ist durch die Zudringlichkeiten ihres Stiefbruders zu einer missbräuchlichen Erfahrung gekommen, aus der sie mit nahm, dass sie mit den Schuldgefühlen ihres Gegenübers zu etwas verdienen kann. Nach dem sie erwischt werden, sie aus der elterlichen kleinen fliegt, geht sie nach München. Hier besucht sie Bars auf, in denen betuchte Herren bereits auf sie erwarten. Als sie den Maler Alexander kennenlernt, der eines Abends volltrunken die Bar betritt, ändert sie ihr leben. Marina nimmt sich seiner an. Irgendwas hat sie an ihm getriggert. Ihre Stimme aus dem Off spricht: Liebe.
Ich bin kein Fan der Rolle der Marina. Ich denke, denke: pathetisch, pathetisch, pathetisch. Das übertrifft sogar jedes mir vorstellbaren 10 Groschenroman. Mir fällt es auch schwer, den Film im Kontext seiner Zeit zu betrachten. Nee, never ever ist das authentisch.
12.08.2025 Krank
Gestern gestürzt, dickes Knie. Arztbesuch. Nichts neues. Kühle das Knie. Zeichne an Motiven des Gendarmenmarkts weiter. Mache viele Pausen.
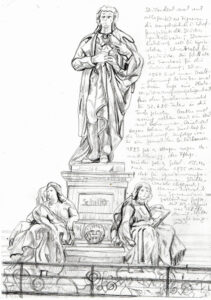
11.08.2025 Atelierbesuch
Rene K., der sich 2024 bei der Ausstellungspräsentation Balancing the Scales. Fairness in the Palette of Art, in meine Installation Shrinking Cties – Rückbau verguckte, ist heute Gast im Atelier. Leider war ich 1,5 Stunden vor seinem Eintreffen im Cafe Rix gestürzt und nun gehunfähig, weswegen ich keine Arbeiten aus dem Lagerbestand zeigen konnte..

8.08.2025 Arbeits-Fünfer-Gruppen Treffen
Mitglied der Arbeits-Fünfer-Gruppe des Atelierhaus Schönstedtstraße 13 gewesen, um kreative Ideen gegen die Abwicklung des Atelierförderprogramms zu entwickeln. Gemeinsam setzen wir uns für die Zukunft unserer Atelierräume ein. Es gibt Ideen und den Willen erfolgreich unsere Interessen zu vertreten, sichtbar sind aber auch strukturelle Hindernisse, die sich bremsend auswirken könnten.
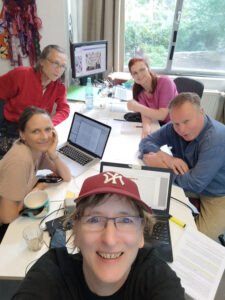
5.08.2025 Visite des Alexanderplatzes
Auf dem Alexanderplatz umlief ich das Alea 101, das am Fuß des Fernsehturms steht. Neben Fotos der Fassade besuchte – erstmals – die Geschäfte im Erdgeschoß darin. Im Jahr 2015 hatte mich das Alea 101 zu der Installation Wagenburg – Eine Oase der Ruhe in mitten der Stadt inspiriert inspiriert. Das Gebäude wurde von 2012 bis 2014 gebaut. In den oberen zwei Etagen befinden sich 14 Wohneinheiten. Engel & Völkers bietet dort u.a. eine Penthouse Wohnung mit 170 m² für 4.194 € monatlich, inclusive Wohnbereich, zwei Schlafzimmern, zwei Bädern, Hauswirtschaftsraum und einer privaten ca. 70 m² Dachterrasse mit Blick über Berlin an. Ein Blick nach oben lässt die Vermutung zu, das viele Wohnflächen des Gebäudes nicht genutzt werden, nicht vermietet sind. Mein aktuelles Interesse für das Objekt hat mit der Arbeit Wem gehört die Stadt? zu tun, zu der dieses Gebäude ebenfalls gehöre soll.

4.08.2025 Petition zum Erhalt der Neuköllner Atelierhäuser
Nach vier Tagen Arbeit konnte ich heute die finale Fassung der Petition zum Erhalt der Neuköllner Atelierhäuser an meine Kollegen des Atelierhaus Schönstedtstraße 13 weiterleiten. Es war dabei hilfreich, dass ich meinen Entwurf mit Nancy Happ und Josephine Riemann durchgehen konnte. Sie haben einen Wortschatz, ich habe einen Wortschatz, man ergänzt sich. Die Bedrohung, dass die Förderungen für unsere Ateliers durch den Berliner Senat nicht erneuert wird, ist real. Ich stehe dann mit meinen ganzen Kunstsachen auf der Straße. Vor allem aber habe ich ohne Atelier gar keine Möglichkeit jemals noch ein Bild in Eitempera zu malen. Das Atelier war durch das Atelierförderprogramm immer gesichert. Jetzt ist gar nichts mehr sicher.
War auch im Atelier malen.
3.08.2025 Atelier
Herrlich – im Atelier an einem Bild zu malen.

Und weil’s mir so gefällt, mein künstlerisches Dasein, entscheide ich mich dazu ein neues anzufangen. Die ersten Konturen mit Tusche finden wie von selbst auf den noch weißen Malgrund.

27.07.2025 Am Gendarmenmarkt gezeichnet
Habe den Gendarmenmarkt abgestritten nach einem geeigneten Standort für eine Zeichnung. Nahm letztlich Platz auf den Stufen des Deutschen Doms mit direkten Blick auf den Französischen Dom. Ich zeichnete das historische Gebäude aber nicht. Zum einen, zu kompliziert, ich fühlte mich aus der Übung. Zum anderen flankierten mein Sichtfeld zu viele Passanten. Ein Eckhaus der Markrafenstraße wählte ich als Motiv, was ich auch an dem Tag fertig stellte.
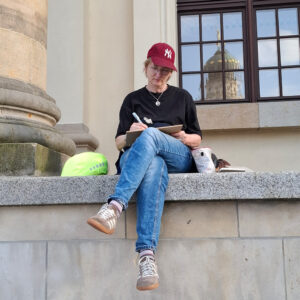

25.07.2025 Happy Fake News Party
Im Rahmen der Ausstellung Schlaustärke. Klimaschutz statt Fake News, im Projektraum GG 3000, findet der Workshop Happy Fake News von Tom Albrecht mit anschließender Party statt. Im Workshop geht es gleich zur Sache. Zuerst redeten wir über den Unterschied zwischen einer Fake News und einer Lüge, die voneinander nicht immer leicht zu unterscheiden sind. Daran anschließend sammelten alle Gäste Fake News. Zum Schluss sortieren wir sie nach Kraft und Subversion. Den besten Drei erwarteten wertvolle Preise mit hoher Symbolkraft! Für meinen Vorschlag Lügenpresse erhielt ich den 2. Platz. Brigitte Bardot, die mich begleitete, für Migranten sind faul zu arbeiten, den 3. Platz. Der 1. Platz ging an einen jungen Mann. für: Die AFD ist nicht rechtsradikal.

22.07.2025 Zaungast bei Anna Netrebko & Yusif Eyvazov
Ich war mit Brigitte Bardot Zaungast des Classic Open Air Konzerts mit der russischen Sopranistin Anna Netrebko, dem aserbaidschanische Tenor Yusif Eyvazov, der georgischen Mezzosopranistin Anita Rachvelishvili und dem argentinischen Bariton Fabián Veloz. Das Konzert wurde wegen starker Regenfälle um einen Tag verlegt. Laut Medienberichten war es nicht ausverkauft. Als Zaungast hatte ich keinesfalls vergleichbare akustische Bedingungen wie die Gäste, die im Zuschauerraum saßen. Das ist deshalb so, weil nicht permanent Passanten an deinen Sitzplatz vorbei schlendern und sprechen. Das Sprechen, das Rascheln, das Füße schlurfen…all das hast du da nicht. Das ist belastend. Ich kann daher nicht sagen, ob die Netrebko ein tolles Dings hat. Ich wurde einfach zu oft, zu häufig abgelenkt.
Anschließend saß ich noch auf ein Getränk mit Brigitte im Erdinger Brauhaus am Gendarmenmarkt. Wir kamen mit einem Ehepaar aus Neuzelle ins Gespräch. Sie hatten Tickets für das Konzert.. Sie erzählten, dass sie beim Betreten des Zuschauerraums von ukrainischen Demonstranten aufgefordert, das Konzert zu boykottieren. Es handle sich schließlich um eine Putin-Freundin, die nicht zu unterstützen sei. Das Ehepaar verwehrte sich gegen diese dumme Aufforderung. Die hätten doch gar keine Ahnung. Ich selbst habe von Protesten gegen den Auftritt von Anna Netrebko nichts mitbekommen.

16.07.2025 Dokumentation
Mit Brigitte Bardot auf dem Alexanderplatz, der voller Menschen ist. Vor dem Kaufhof ist eine Bühne aufgebaut von der es laut herunter blökt. Gegenüber an der Weltzeituhr ebenfalls heftiges Geblöke, durch einen einzigen Mann an einem Bass. Eine Eisverkäuferin weiß davon zu berichten, dass der Platz die Vorort zur Hölle ist. Was hier für Zeug rumrennt. Auch vor der Polizeistation gibt es keinen Respekt. Vorige Woche war sie Zeugin, wie ein Polizist Scheiße vor deren Tür weggemacht haben.
Ich betrachte die Baustelle des Covivio-Towers. Der Sockelbau ist abgeschlossen. Die ersten Etagen des Turmes sind installiert. Neben Handels- und Geschäftsräumen werden dort auch Wohnräume entstehen. Ich höre im Bewusstsein der neuen Wohneigentümer – es werden doch keine Mieter sein bei der prominenten Lage – hin. Betrachte die Menschen auf dem Platz. Jeder und alles will etwas sein. Das werden die darin dann betrachten. Von denen kann man dann alles mithören. – Live, versteht sich. So viel Luxus muss schon sein. Auch der Mynd-Tower ist gewachsen, der am Kaufhof Gebäude klebt. Ich will, muss meine Arbeit an Wem gehört die Stadt dringlichst weiterführen.

13.07.2025 Biennale Berlin
Heute einen Ausflug zur Biennale Berlin, in die Lehrter Straße 60, gemacht mit Brigitte Bardot, wo wir Sandra und Yvonne trafen. Auf zwei Etagen, eine überschaubare Kunstmenge mit aktuell politischen Hintergründen über Unterdrückung und Repression u.a. Oftmals ohne Hinweistafel ablesend, nicht in dem Kontext, wie der Kurator es darstellt, zu verstehen. Was nicht schlimm ist, solange überhaupt was daran inspiriert.
Mir gefiel besonders die installative Arbeit von Elshafe Mukhtar, When Bots Rule a Great Nation [Wenn Bots eine große Nation regieren]. Elshafe Mukhtar bezieht sich auf die ersten Tage des Kriegs, der nach dem Zusammenstoß zwischen den paramilitärischen Rapid Support Forces (RSF) und den Sudanesichen Streitkräften (SAF) des Landes seit dem 15. April 2023 im Sudan tobt. Es handelt sich dabei um den dritten größeren innerstaatlichen Konflikt im Sudan nach den beiden Sezessionskriegen. Unter den ersten Zielen der RSF waren Museen und Archive, worauf Mukhtar u.a. direkt Bezug nimmt. Mir gefällt die Reduktion der Zeichnung sowohl in Linie wie in Farbe.
P.S. Die anderen Standorte der Biennale besuchen wir auch bestimmt noch.

11.07.2025 Konzerthaus Berlin
Am Konzerthaus dirigiert Joana Mallwitz das Musikstück Schelomo – Hebräische Rhapsodie für Violoncello und Orchester, von Ernest Bloch. Sheku Kanneh-Mason, gerade Artist for Residence am Konzerthaus, spielt das solistische Violoncello. Das Cello steht hier stellvertretend für die Stimme Salomos, die anderen Instrumente, das vielstimmige Volk.
Nach der Pause dirigierte Mallwitz von Dmitri Schostakowitsch, die Sinfonie Nr. 11 g-Moll op. 103 „Das Jahr 1905″. Die Sinfonie setzt sich kritisch mit der Geschichte Russlands auseinander. Das macht sich auch in der Dramatik und fülle der Instrumente bemerkbar. Es ging richtig zur Sache. Streicher, Bläser, Harfe, Blech- und Schlaginstrumente. Ich war beeindruckt vor allem von den militärischen Schlaginstrument-Sequenzen und der Trompete.

10.07.2025 Atelierbesuch
Gäste, die nicht zu @48stundennk kommen konnten, konnte ich heute doch noch mit auf Entdeckungsreise meiner Bilderwelt mitnehmen. Beide sind langjährige und große Fans meiner besonderen malerischen Perspektiven.

9.07.2025 Absurdität und Atelier
Der Wortlaut: „Die Bedeutung von Energieeffizienz in der Kunstbranche lässt sich nicht leugnen. Bei meinem Besuch auf Ihrer Homepage a-streit.de war mir sofort klar, dass Ihre vielfältigen künstlerischen Projekte nicht nur kreativ, sondern auch ressourcenschonend gestaltet werden können. Ihre Arbeiten wie Die Beauftragte und“ so weiter, das erreichte mich heute per Email. Mir wird ein Gespür für Nachhaltigkeit bescheinigt von der Adressatin Sarah S, Cham, Schweiz. Es bestehe die Möglichkeit einer Förderung wenn das Energieaudit meiner Beauftragten sowie künstlerischen Arbeit ein durchschnittliches Einsparpotentiale von 19,4% ausweist. Sie können mir Photovoltaikanlagen, verschiedene Leuchtmittel und Optimierungen meiner bestehenden Abläufe empfehlen. Zuerst würde ein unverbindlicher Termin vereinbart, bei ich geprüft werde, ob ich für die Förderung berechtigt bin. Anschließend erfolgt die Einreichung beim Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA), daraufhin kommt ein staatlich geprüfter Auditor… gefolgt von einem Abschlussgespräch… „In der Branche habe der Adressat bereits zahlreiche Einsparmöglichkeiten identifiziert, die auch mich in der künstlerischen Arbeit unterstützen könnten. „Wann haben Sie nächste Woche Zeit …?
Meine Beauftragte, aha, ich musste lachen. Die Vermutung liegt nahe, das ChatGPT Webseiten nach bestimmten Schlagworten durchsucht hat und so auf mich aufmerksam wurde.
Später im Atelier: Erwarte morgen Atelierbesuch. Erst male ich, dann verbringe ich 26 Arbeiten aus Lagerbeständen in mein Atelier zur Ansicht.
8.07.2025 Wolfsburg, Museum
Mit dem ICE fahre ich für 7,99 € nach Wolfsburg, wo ich Nancy Happ treffe. Wir besuchen die Ausstellung Schwerelos, mit fünf Werken von Leonardo Erlich, im Kunstmuseum Wolfsburg.
Wir steuern zuerst in der großen, komplett abgedunkelten Kunsthalle die 13 Meter hohe Rakete an, die an einer Empore andockt. Im Inneren sind verschiedene Spiegel eingebaut, die die Insassen aus unterschiedlichen Perspektiven zeigen. Vom Boden aus, auf Augenhöhe, ist ein Guckfenster eingelassen, durch das ich Nancy beobachte. Sie liegt in X-Meter Höhe im Inneren der Rakete auf einer stabilen Acrylglasplatte sich abgelegt und in Bewegungen gerät, die Schwerelosigkeit nachahmen. Sie strengt sich an, gibt alles. Ist die Beste! So bald sie sich allerdings nicht bewegt, ist sie nur ein bekleideter Klecks weit oben über meinem Kopf. Ich mache Videos und Fotos davon. Die Illusion einer Schwerelosigkeit kann ich nicht erkennen. Im schwerelosen Raum gibt es keinen Zustand, wo man seine Gewichtskraft spürt. Als ich mich selbst etwas später auf der Acrylglasplatte zum Affen mache, spüre in jedem Moment, dass ich nicht im Raum frei von Schwerkraft bin. Erlichs Versuch, durch visuelle Mittel zu erzeugen, ist als fehlgeschlagen. Und wenn Niemand da ist, der einen dabei fotografiert oder filmt, bleibt nur die Erinnerung an eine Aktion ohne echtes Erleben.
Eine Aufsichtsperson erklärt mir, dass es erlaubt und erwünscht ist, Bilder zu machen. Klar, damit wird die Ausstellung kostenlos virtuell beworben.
Ein halber Mondkörper aus einer Holzunterkonstruktion, Styropor, Putz, Farbe von etwa 20 Meter Durchmesser ruht, gemäßigt ausgeleuchtet, im Raum und wartet auf seine Entdeckung. Ein schmaler Zugang führt hinein. Im Inneren erwartet einen eine 360-Grad-Rundumprojektion aus Sternenkonstellationen und Bildern nächtlich hell erleuchteter Orte mitsamt ihren Straßennetzen. Die Bodenfläche der Kuppel ist verspiegelt, eine Rundumprojektion trifft auf die Innenhaut der Halbkugel wie auf den Borden. Das Gleichgewicht gerät ins Wanken. Sphärische Klänge begleiten die abgespielten Bildfolgen. Aus der Perspektive eines Körpers in der Luft, der sich ins Weltall bewegt, werden Nancy und ich in einer Dauerschleife immer wieder die selben Bilder sehen. Zu Beginn ist die Ansicht der Erdoberfläche aus etwa 200 Meter Höhe. Mit zunehmender Höhe verwandeln sich die noch eckigen Flächen in Kreise, die immer schneller und kleiner werden, bis sie hektisch flirren und schließlich das Weltall erreicht ist – hier erkenne ich die Milchstraße.
Wir machen unzählige Fotos. Meine Sympathie für die Installation ist sehr niedrigschwellig. Der halbrunde Raum und die Projektionen erinnern mich doch zu sehr an Besuche im Planetarium. Nur das Hörspiel mit Wissenswertes über den Weltraum fehlen.

Das Haus Pulled by the Roots ist ein Nachbau eines Bürgerhauses, aus der Weinbrenner-Ära im Maßstab 1:1. Im Jahr 2015 hing es an einem Baukran in Karlsruhe über dem Marktplatz. Die aus den Fußboden ragenden Baumwurzeln sollen den Eindruck vermitteln, als sei das Haus gerade rüde aus seinem urbanen Kontext herausgerissen wurden. Aus Anlass der bevorstehenden 300-Jahrfeier wurde die Stadt auf Links gekrempelt, was dazu führte, dass es unzählige Baustellen gab, die zu Behinderungen über mehrere Jahre führten. Unter dem Titel Die Stadt ist der Star – Kunst an der Baustelle haben Stadt und ZKM zwölf Orte in der Stadt mit Installationen, Happenings und temporären Großskulpturen bespielt. Eine dieser Orte war das Haus am Kran. Interessanter Hintergrund, die Arbeit ohne diesen Baustellenkontext im Kunstmuseum Wolfsburg zu präsentierten ist dagegen unvorteilhaft. Es entwertet es, macht das Kunst am Bau-Werk zu einer musealen toten Masse. Schade, schade.
P.S. Auch hier wieder nur nette Fotos und das Fazit: Ding ohne echtes Erleben.
Das Werk Die Cloud ist wohl die am wenigstens beachteste Arbeit der Ausstellung, obwohl man direkt nach Eintreten in die Halle darauf zuläuft. Sie besteht aus Digitaldrucken, die mit Keramiktinte auf ultraklarem Glasscheiben durch LED-Leuchten in einer Holzvitrine in Szene gesetzt werden. Steht man direkt vor der Vitrine, sieht man eine Wolke, in einem kaltem Weißton. Tritt man an die Seite, eröffnet sich ein anderes Bild. Es sind 9 Glasscheiben, die hintereinander verbaut, verschiedene Wolkenbilder darstellen. Jedes Bild unterscheidet sich von den der anderen. Ich komme ins Schwärmen: Es erinnert mich an den Aufbau von Malerei. Da wird geschichtet, Farbe auf Farbe. So entsteht Tiefe und die Illusion, es handle sich um einen 3-Dimensionalen Raum, obwohl das nicht geht, auf Flachware (Ausdruck für 2-dimensionalen Maluntergrund). Die Illusion eines 3-D Raums gelingt Erlich hier. Es habe echt was damit erlebt.
7.07.2025 Ich Zeichne
Ich zeichne erneut das Konzerthaus, diesmal im Format DIN A4. Tue mich wie gestern immer noch schwer mit dem Thema Berliner Gendarmenmarkt. Um es mir mit dem Zeichnen nicht ganz zu verderben, entschließe ich mich das Sujet zu wechseln. So zeichne ich zu meiner Serie Ukraine-Krieg, Vladimir Selenskyj und Ursula von der Leyen, was mir leicht von der Hand geht. Auch das verwendete Papier ist gut. Ich weiß allerdings nicht, was das für eine Papiersorte ist.
6.07.2025 Ich zeichne
Zeichne Motive vom Gendarmenmarkt. Tue mich schwer. Auch das Papier macht mir Ärger. Bin genervt und unmotiviert. Es kommt zu Ausschuss.
5.07.2025 Recherchearbeit
Heute verbringe ich Zeit mit Recherchen zur Sanierung des Berliner Gendarmenmarktes. Neben eigenem Fotomaterial werde ich für meine geplante mehrteile Zeichnung des Gendarmenmarkts auch auf Material aus dem Internet zurückgreifen. Interessant zu erfahren dabei war, dass der Platz einst mit geschützten Grünflächen versehen wurde. Diese Flächen mussten mit Machtergreifung der Nationalsozialisten weichen. Der Platz sollte als Aufmarschplatz für propagandistische Veranstaltungen dienen. Seit 1936 wird der Platz von einem großflächigen Muster quadratischer Platten dominiert, das in Grundzügen noch vorhanden ist.
4.07.02025 Vernissage-Besuch: Schlaustärke. Klimaschutz statt Fake News – Dokumentation
Mit Brigitte Bardot habe ich die Vernissage Schlaustärke. Klimaschutz statt Fake News – Dokumentation, des Projektraum Group Global 3000 – Galerie für nachhaltige Kunst besucht. Künstler thematisierten darin den Umgang mit Fake News in Politik, Presse und in Social Media. Verschiedene Ansätze wie Medien fanden Verwendung. Ich traf Maria Korporal, Merit Fakler und Tom Albrecht, die für den Projektraum arbeiten bzw. an der Ausstellung beteiligt sind.

3.07.2025 Atelier
Präsentationen von 48 Stunden Neukölln entfernt und ins Lager gebracht. Anschließend eine kleine Zeichnung vom Atelierhof angelegt und etwas gemalt.
1.07.2025 Gendarmenmarkt, Hitze
Sitze am Abend auf dem Gendarmenmarkt. Die Tagestemperaturen in Berlin zeigen 37-38 Grad Celsius an. Der Platz hat tags ordentlich Sonne getankt. Es ist mir nach Abkühlung. Ich denke über die vergangenen Diskussionen, um die kürzlich abgeschlossene klimagerechte Sanierung des berühmten Platzes nach. Mein Interesse für den Gendarmenmarkt steht mit der Ausstellungsbeteiligung Dialog der Zeiten – Zwiegespräche, bei der ich mich auf eine Arbeit aus dem VBK-Archiv des Grafikers Eberhard Franke (*1936-2004) beziehe. Franke war ein Chronist der Stadt, unter anderem hat er auch Grafik des Gendamenmarkt 1995 angefertigt. Franke hat den Gendarmenmarkt seinerseits abgebildet, ich werde es dabei nicht belassen, sondern mich in dem Zusammenhang mit der kürzlich beendeten klimagerechten Sanierung des Platzes befassen.
Lese Kritiken dazu im Internet. Die Kritiker sind sich einig, dem Platz fehlt es an Natur.
P.S. Ein, zwei Straßenlaternen vom Gendarmenmarkt hätt ich gern auch vor meiner Tür.
30.06.2025 Zeughauskino, Reihe: Bezeugen und erzählen
Der Film, Lang ist der Weg, von Herbert B. Fredersdorf und Marek Goldstein, wurde von 1947 bis 1948, in Deutschland (ABZ) gedreht. Es ist der erste und bisher letzte Spielfilm in jiddischer Sprache. Er stellt das Leben der Holocaust-Opfer bzw. -Überlebenden in den Mittelpunkt. Neben Spielszenen werden auch einige Dokumentarszenen verwendet, was für die noch junge Filmgeschichte selten Anwendung fand (meine Vermutung).
Der Film erzählt die Geschichte der jüdischen Familie Jelin. Mutter Hanna und Vater Jakob Jelin erleben mit ihrem erwachsenen Sohn David den deutschen Angriff auf Polen, die anschließenden Repressalien des NS-Regimes, die Zuweisung ins Warschauer Ghettos, die Deportierung ins Vernichtungs- und Arbeitslager Auschwitz, wo sich erstmals Wege der einzelnen Familienmitglieder trennen. Sohn David flieht aus den Deportationswagon und schließt sich bis Kriegsende den Partisanen an. Nach Kriegsende zieht es ihn nach Warschau zurück, wo er seine Mutter hofft zu finden. Dabei lernt er Dora, eine deutsche Jüdin kennen. Sie werden ein Paar. Die Mutter hat Auschwitz überlebt, der Vater wurde dagegen sofort vergast.
Thematisiert wird im Weiteren die Befreiung der Holocaustopfer sowie Stationen der Rückführung der Menschen in ihre Herkunftsländer. Verschiedene Flüchtlingslager, in denen auch Opfer des Holocaustüberlebende zu meinem Erschauern in eingezäunten Ghettos verbracht werden. Ich mag mir gar nicht vorstellen, was da in den Menschen vorgegangen ist.
Zum Ende des Films wird die Übertragung des jüdischen Kongresses dargestellt, der die Schließung der Lager und die Öffnung Palästinas als neue Heimat fordert. Schließlich finden sich Mutter und Sohn auch durch eine Suchanzeige wieder.
29.06.2025 Last Day: 48 Stunden Neukölln
Heute zählte ich mehr Besucher im Atelier zu den Vortagen. Gespräche führte ich über den Müther Turm in Binz, den ich bei meinem Ostseeaufenthalt im November 2024 zeichnete. Der ehemalige Rettungsschwimmerturm ist sehr bekannt unter Ostsee-Kennern. Auch seinen Architekten Ulrich Müther kennt man. Die Zeichnung ist häufig Anlass für Gespräche. Ich präsentiere das Werk daher nicht ohne Kalkül. Mit einer Ingenieurin kam ich ins Gespräch über Verknüpfungen zwischen Kunst und Wissenschaften. Das bot auch die Gelegenheit auf meine Konzeptarbeit Die Beauftragte hinzuweisen. Auch politische Themen zum Krieg zwischen Israel und Iran kamen zur Sprache, wie in dem Zusammenhang stehenden News des Präsidenten der USA zum Abwurf seiner Super-Panzerbombe über die Atomanlagen des Irans… Beunruhigendes eben.
Da Brigitte Bardot mich unterstützte, besuchte ich auch die anderen Ateliers im Atelierhaus, die in großer Zahl geöffnet waren. Mit Lou Favorite habe ich mich etwas ausführlicher unterhalten. Er „lebt“ in einem dunklen Atelier mit vielen hohen Regalen. Die Fenster sind vor Blicken von Außen mit Stoffen verhangenen. Große Arbeitsplatten, auf denen seine collageartigen abstrakt-figürlichen Farbzeichnungen liegen, dominieren den Raum bedeutungsvoll und lassen erahnen, das Lou hierauf seine künstlerische Arbeit verrichtet. An den freien Wandflächen sind verschiedene seiner Papierarbeiten zu betrachten. Sehr anders als bei mir.

28.06.2025 48 Stunden Neukölln
Juchhu, da liest eine Besucherin in meinem 2019 veröffentlichten Arbeitsjournal 2 Die Beauftragte. Ich könnte vor Freude ein Rad schlagen. Die an Wissenschaft orientierte Konzeptarbeit zum Thema Lärm- und Vibrationsarbeitsschutz hat mir bei der Umsetzung so viel Freude gemacht, dass ich heute noch breit Grinse, wenn ich damit in Berührung, in Erinnerung komme.

27.06.2025 48 Stunden Neukölln
300 Veranstaltungsorte meldet der Veranstalter von 48 Stunden Neukölln. Das Atelierhaus Schönstedt 13 meldet höchste Beteiligung seit 2006. Die Besucherzahlen sind mau. Sicherlich wird es morgen besser.
26.06.2025 Atelier
Heute herrichten des Ateliers für die Gäste der Offenen Ateliers, im Rahmen des Kunst und Kulturfestivals Neukölln. Das dauert etwa 12 Stunden.

25.06.2025 Berliner Ensemble, B.B.
Brigitte Bardot und ich sahen die Aufführung Die heilige Johanna der Schlachthöfe, von Bertolt Brecht, im Berliner Ensemble. Die Regie führte der mir bis dahin unbekannte Dušan David Pařízek. Das Stück bezieht sich auf Krisen des Kapitalismus im Angesicht der Weltwirtschaftskrise von 1929 und ihrer Folgen, die sich stetig wiederholt. Ganz gemäß Marx’scher Theorie, mit denen sich der Dramatiker zu dieser Zeit umfänglich beschäftigte. Mitautoren sind Elisabeth Hauptmann und Emil Burri.
Die tragische Figur des Stücks ist die gutgläubige Johanna Dark, gespielt von Kathleen Morgeneyer. Sie arbeitet für die Schwarzen Strohhütte, eine Art Heilsarmee. Dark möchte den ausgesperrten Arbeitern in den Chicagoser Schlachthöfen den Glauben an Gott näherbringen. Zu Beginn macht sie die „Unterprivilegierten“ selbst für ihr Elend verantwortlich und unterstellt ihnen einen Mangel an „Sinn für das Höhere“. Sie glaubt, dass der arme Mensch nur dann „Höheres“ erreichen kann, wenn er es auch will – was mich an dieser Stelle zum Kichern brachte. Im Verlauf des Stücks erkennt sie ihren Irrtum und versucht angesichts des Elends, den Fleischkönig Mauler, gespielt von Stefanie Reinsberger, dazu zu bewegen, die Schlachthöfe zu öffnen, damit die Arbeiter wieder Lohn und Arbeit haben. Doch Mauler, hin- und hergerissen zwischen Gefühl und Geschäft, entscheidet sich am Ende für den Wachstum seines Vermögens und den Ausbau zu einer (Super)Macht usw.
Dušan David Pařízek hat als Kleingedrucktes im Programmheft den Fremdtext Atlas Shrugged von Ayn Rands eingefügt, kurz bevor Johanna vor den Toren des Schlachthofs völlig entkräftet und halb tot zu den Schwarzen Strohhütten zurückgebracht wird. Praktisch war es so, dass die Schauspieler von der Bühne abgingen außer Stefanie Rheinsberger. Sie erklärte dem Publikum, dass sie machen könnten was sie wollten, sie aber habe so eine Spielwut, sie müsse jetzt weiter spielen. Kaum den Satz beendet trug sie das freiheitsliebende Manifest vor. Nein Vortrag ist nicht korrekt, sie wetterte lauthals und sehr gestisch als Vertreterin der Kapitalist*innen (aka Verstandesmenschen, Händler und Erbauer) gegen die Schmarotzer und „Nullen“. In dieser Rolle unterschied sie sich deutlich von der Rolle des Fabrikanten Maulers. Die Zuschauerreihen leerten sich. Brigitte und ich blieben sitzen, uns erinnernd an früherer Zeiten, wo Zuschauer zu Mitspielern wurden – unfreiwillig.
Es gäbe sehr viel zu kommentieren, so toll war es. Ich beschränke mich aber jetzt nur auf die Höhepunkte: Zum Einen, das minimalistische Bühnenbild mit zweiter Bildebene – den Schattenbildern mittels Projektoren-Licht. Das weckte das Kind in mir und die Malerin. Im weiteren, die Darsteller: Die Besetzung des Fabrikanten Maulers mit einer Frau und dann auch noch mit Stefanie Reinsberger, die durch ihre Statur ihre Rolle in Schräglage brachte, die Brecht sicherlich gefallen hätte. Herrlich die Szene, Maulerim Seitenprofil in Unterwäsche, Schatten an Wand, Betonung liegt auf Maulers Bauch, den sie wiederholt nach vorne schiebt. Dann auf ihm mit Händen trommelt. Oder wie sie
Na und die Johanna Dark mit Kathleen Morgeneyer zu besetzen, das war ebenfalls ein Kunstgriff. Sie hat die vermeintlich sichere Frau, die im Schutz ihres Herrn und ihres Glaubens, sich in Sicherheit wähnt, zu einer bedrückenden, gebrochenen Winzigkeit geführt.
Fazit: Chapeau, Chapeau! Ich habe mir das Buch zum Stück gekauft. Ich möchte es mir in der nächsten Spielsaison ein weiteres Mal ansehen.
Podcast: http://www.berliner-ensemble.de/index.php/magazin/von-wirtschaft-und-moral
24.06.2025 Atelier
Eigentlich sollte ich Vorbereitungen für den anstehenden Event Offene Ateliers, im Rahmen des Kunst und Kulturfestivals Neukölln, aber ich habe keine Lust auf Aufräumen und Kunstwerke in Präsentationsansichten zu bringen. Ich male. Es tut mir gut, das zu tun.
22.06.2025 Atelier
Packe das Tableau Was guckst du?, 2006, für die Reise nach Bonn, auf dem Helmut Lorscheid abgebildet ist lebt. Im August wird das Tableau im HOTSPOT KW, in Königswinter ausgestellt. Das ist erfreulich.
Anschließend male ich an dem Jogger weiter. Abgang.
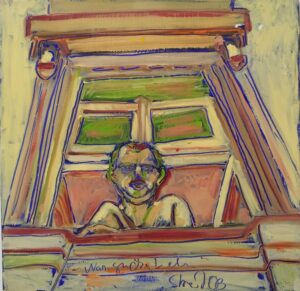
21.06.2025 Staatsoper für Alle
Seit 2007 veranstaltet die Staatsoper Berlin, die Staatsoper für Alle. Der Event steht für die Vision, Oper und klassischer Musik für jeden zugänglich zu machen. Praktisch heißt das, dass die Aufführung Staatsoper live via Videoleinwand übertragen wird. Während die Gäste im Opernhaus mindestens 98,60 Euro für ein Ticket zahlen, können wir „Draußen“ die Aufführung gratis miterleben. Auf dem an das Opernhaus angrenzenden Bebelplatz oder Unter den Linden sitzt man unter freiem Himmel auf gemieteten oder mitgebrachter Sitzgelegenheiten und genießt. Punkt 19 Uhr beginnt es. Romeo et Juliette, nach William Shakespeare, von Charles Gounod, wird in Starbe-setzung mit Tenor-Weltstar Juan Diego Flórez als Roméo und der gefeierten Sopranistin Nino Machaidze als Juliette vorgeführt. Ich wundere mich dann etwas über den „Erzählstoff“. Im ersten Akt lernen sich Romeo und Juliette kennen. Dann gleich Bumm… dein Antlitz ist tadellos.. ich muss dich wiedersehen… ich dich auch. Ab zweiten Akt nur noch Probleme und Heimlichkeiten. Das Ende, der Tod Romeo‘ s – sogar ein Versehen. Juliette will nicht ohne ihn und rahmt sich einen Dolch tief in die Brust. Hätte Gounod nicht einen eigenen Schluss erzählen können? Romeo kommt in die Gruft… heult rum, will nicht ohne sie…sucht nach dem Gift… hebt die Ampulle dramatisch über den Kopf. Nimmt sie ins Visier, spricht: So sei’s drum. Just im Ausklingen des letzten Wortes räuspert sich Juliette. Er dreht sich zu ihr: Oh, du lebst. Küsse. Er: Liebste, lass uns fliehen. Stemmt sich gegen die Tür, aber die Gruft wurde von außen verschlossen. Kein entrinnen. Der Tod ist dem Paar sicher. In Anerkennung ihres nahenden Endes ist noch Zeit für eine finale, gemeinsame Liebesarie. Dann Sauerstoffnot und Kälte und langsam schleichender Tod.
Ich will aber nicht Meckern, die Aufführung war gut.

20.06.2025 FilmDokument
Das Zeughauskino präsentiert unter dem Titel FilmDokument wenig bekannte, nicht-fiktionale, deutschsprachige Werke. Mathias Barkhausen, Filmwissenschaftler, Mitarbeiter des Erich Pommer Instituts und Mitglied der CineGraph Babelsberg stellt die Dokumentarfilme Gundula Jahrgang `58 & Unsere alten Tage vor, die sich der Frage beschäftigen: Wo wohnen alte Leute? Laut Barckhausen waren Feierabendheime, wie in der DDR genannt, mit geringen Standards ausgestattet, sehr funktionell ausgerichtet. Die Bezahlung und Anerkennung für die Arbeit, die von Krankenschwestern und Hilfspflegekräften ausgeübt wurde, war schlecht. Die Arbeit schwer, die Personaldecke niedrig. Ich selbst habe keine Kontakte zu Bewohnern eines Feierabendheimes, aber durch das berufliche Umfeld meiner Mutter und eigener Arbeit in einer Kinder- und Jugendpsychiatrie Kenntnisse zu Arbeitsumständen im Gesundheitswesen gesammelt und deshalb kam mir einiges durchaus sehr bekannt vor.
Der Film Gundula Jahrgang `58, in der Regie von Gitta Nickels, betonte merklich die Nebentätigkeit seiner Filmheldin.
Gundula, 24 Jahre jung, dunkelhaarig, Kurzhaarschnitt, hübsch, Frontfrau der Band Trend, im Beruf examinierte Krankenschwester. – Nun tätig in einem Altenheim in Neubrandenburg mit Wunsch auf Weiterqualifizierungen.
Die erste Szene führt den Zuschauer in eine Garderobe, in der Gundula sich mit Männern umkleidet. Kamera auf sie: Sie steigt mit Unterwäsche bekleidet auf einen Stuhl, zieht eine helle Hose an. Steigt vom Stuhl, setzt sich. Betrachtet sich im Garderobenspiegel. Kümmert sich um ihr Gesicht. Schminkt sich. Zieht Schuhe an. Steht auf. Abgang. Auftritt Bühne mit weißen Unterhemd, Hose, Schuhe mit Spitzenbesatz am Dekolletee, mit dünnen Trägern. Gundula – oben rum mit …, singt. – Singt erstaunlich gut. Während des Filmes weitere Szenen mit ihr und ihrer Band bei Proben und Auftritten.
Der Film lässt sie selbst zu Wort kommen: Ich bin nach Neubrandenburg umgezogen nach meiner Ausbildung, ich nehme an, dass das mit meiner Stimme nicht lange geht. Dann, wenn ich nicht mehr singen kann, starte ich beruflich richtig durch. Ich möchte selbst eine Stationsschwester werden. Dass sie eine alleinerziehende Mutter einer kleinen Tochter ist, wird erst im letzten Drittel thematisiert. Gundula ist mir sympathisch. Die Bewohnern mag sie und die mögen sie. Überhaupt überträgt sich Gundula`s positive Grundstimmung auf ihre Umgebung und auch auf mich. Unangenehm empfinde ich eine Szene mit der Stationsschwester, einer weiteren Krankenschwester und einem älteren Herrn mit Parteiabzeichen. Im Gespräch wird ihre mangelnde Einsatzfähigkeit kritisiert, obgleich zu gleichen Teilen man ihre große Einsatzfähigkeit lobt. Indirekt steht der Vorwurf im Raum, das Gundula wegen ihrer Bandaufritte Extrawünsche für den Dienstplan hat. Die Bewohner mögen sie sehr, wird betont. Es ist zu spüren, dass die junge Kollegin gemocht wird, man ihr aber auch eine Exotin sieht. Eine Qualifizierung in ihrem Beruf kann sich Gundula erstmal abschminken. Sie muss sich verbessern. Die „andere Schwester“ schlägt vor, das Gundula mit ihrer Band im Heim auftritt. Mit dem Auftritt endet der Film. Der Speisesaal ist voll besetzt. An den vorderen Tischen das Kollektiv, drum herum die alten Leute. Ein Bewohner, mit russischen Wurzeln bedankt sich für ihren Musikalischen Beitrag, überreicht ihr einen schmächtigen, aber wertvollen Blumenstrauß und drückt ihr einen Kuss auf die Wange. Der Mann strahlt übers ganze Gesicht.
P.S. Gundula hat im Film immer wieder den Ute Freudenberg Song Wie weit ist es bis ans Ende dieser Welt gesungen.
In Unsere alten Tage, DDR 1989, hat die Regisseurin Petra Tschörtner in s/w Format gedreht, was einerseits versachlicht, ebenfalls aber auch eine bedrückte Stimmung mit transportiert. Tschörtner hat im Weiteren ihre Protagonisten gegenüber eine beobachtende Haltung eingenommen. Das führte zu „echten, authentischen Szenen“. Bspw. als eine Pflegerin mit einem Servicewagen einen langen dunklen Flur von Tür zu Tür geht und aus großen Kübeln Milch, Milchsuppe, in von den Bewohnern mitgebrachte Behälter füllt und außerdem Brot, Belag usw. an die Bewohner nach Anfrage übergibt. Das Personal, die Frühstück austeilende Pflegekraft, funktional auf das Austeilen des Frühstücks beschränkt. Nimmt außerhalb dieses Tuns nichts wahr. Rückt nicht von ihrem Servicewagen ab. Einige Bewohner hatte Tschörtner zuvor dem Zuschauer in etwa so vorgestellt: Alte Frau, ihr gegenüber sitzt eine Pflegekraft. / Alte Frau, sie wissen dass das ein Zweibettzimmer ist? Alte Frau: Ja. Es muss passen. / Alte Frau sitzt auf Bett. Pflegerin betritt mit hagerer, alten Frau das Zimmer: Guten Tag Alte Frau. Das ist Hagere Frau. Ich zeige ihr das Zimmer. Zur Hageren Frau: Das ist der Schrank. (Öffnet die Türen.) Hier können sie ihre Sachen reintun. (Zeigt drauf.) Hier eine Kleiderstange, dort die Schrankfächer. (Zeigt auf ein kleines Schließfach im Schrankteil links.) Das ist ein Schließfach. Hier können sie ihre Wertsachen reintun. (Dreht sich zum Balkon.) Das ist der Balkon. Wollen wir mal auf den Balkon gehen? (Wartet nicht auf Antwort, führt die Hagere Frau auf den Balkon.) Hier können sie frische Luft schnappen. Abgang./ Pflegerin betritt Zimmer Alte Frau. Alte Frau, was denken sie, kann die Hagere Frau bei ihnen wohnen? Alte Frau: Ich denke nicht. Ihr Gesicht gefällt mir nicht./
Ein andere Szene porträtiert vier Frauen an einem Tisch sitzend, jede von ihnen in sich gekehrt, abwesend wirkend. Vier Betten, vier Nachttische. Ein großes Fenster. Keine persönlichen Sachen zu sehen. Die Frauen sprechen nicht. / Ein Mann auf einem Stuhl. Schaut in die Kamera: Ich habe ein Zimmer für mich allein. / Ein Saal mit den Bewohnern an Tischen sitzend. Auftritt Kindergruppe und eine Erwachsene. (Singen.). Eine Erwachsene spricht zu den Bewohnern: Wir wünschen unserer sozialistischen Republik alles Gute zum 40. Geburtstag.
Fazit: Durch die Wahl in s/w zu drehen, die Bewohner hauptsächlich zu beobachten, sie selbst kaum zu Wort kommen zu lassen wirkt der Film überhöht auf mich. Ich erfahre was die Regisseurin über das Leben im Altersheim denkt, nicht was die Menschen dort leben, selbst darüber denken.
Eine anschließendes Gespräch hätte mir gefallen, aber das gab es an diesem Abend nicht.
19.06.2025 Atelier
Ich schlage mich wiedermal mit der Bildfläche vom Bild mit sitzenden Jogger rum. Immer diese Auseinandersetzungen, das nervt.
17.06.2025 Zeughauskino, Reihe: Was von der DDR bleiben sollte (Siehe auch 23., 24., 27.05. und 13.06.2025)
Der letzte Veranstaltung der Reihe: Was von der DDR bleiben sollte, steht unter dem Thema Kunst und Kultur. Fünf Personenporträts werden vorgestellt wie folgt: Jurij Brezan. Schriftsteller. geb. 9.6.1916 in Räckelwitz, DDR 1978-1979; Prof. Dr. Wilhelm Girnus I. geb. 27.1.1906 in Allenstein (Olsztyn). Literaturwissenschaftler und Publizist, DDR 1977, Christian Richter. Christ und Keramiker, DDR 1983, Erwin Geschonneck. Schauspieler. Geb. 27.12.1906 in Berlin, DDR 1975-1976, Stephan Hermlin. geb. 15.4.1915 in Chemnitz. Schriftsteller, DDR 1981
Anne Barnert, Wissenschaftliche Mitarbeiterin im Forschungsverbund Diktaturerfahrung und Transformation und Autorin der Publikation „Filme für die Zukunft“ und Andreas Kötzing, Historiker, Kurator und Autor, Wissenschaftlicher Mitarbeiter am Hannah-Arendt-Institut für Totalitarismusforschung in Dresden, führen durch den Abend.
Im ersten Filmausschnitt sitzt der sorbische Schriftsteller Jurij Brezan bereits an seinen Arbeitsplatz, der Ordnung und Klarheit wiedergibt. Er referiert über seine Arbeit, um die bekannte sorbische Sagefigur Krabat.
Fünf Jahre hat er daran gearbeitet, sich den Sagenstoff zu-eigen-zu-machen. Seiner Einschätzung nach, sind die jüngeren Menschen mit der Mythen- und Sagenwelt ihrer Ahnen nicht vertraut. Verstehen nur Bahnhof. Er schreibt den Krabat neu, so verstehe ich es, um die Sage, die er für so wichtig hält, dem sozialistischen Kulturgedächtnis „zurück“ zuführen. (- Meine Interpretation.) Er sagt wörtlich: „Die Kenntnis der Mythen ist eigentlich die erste Kenntnis der Literatur. Auch der Völker, des Denkens über die Welt. Und es verarmt, das nicht zu wissen.“ Brezan hat insgesamt drei Bücher über „seinen“ Meister Krabat geschrieben. Das wird aber im Filmdokument nicht erwähnt.
Bei der Nachschau im Bundesarchiv des kompletten Films kommt auch seine Schwester zu Wort. Sie betont seine Heimatverbundenheit und seinen Familienzusammenhalt. Dann stellt sie fest: Er habe keinen Stolz. – Führt als Beweis an, dass Brezan sich nicht über Andere stellt. Jedes Jahr veranstaltet er ein Fest für die Menschen im Dorf. E ist beliebt. Eine nicht näher bezeichnete Frau macht Bozan dafür verantwortlich, dass sie Lehrerin geworden ist. Sie unterstreicht ebenfalls seine freundliche, zugewandte Art usw.
Link zum Beitrag: https://digitaler-lesesaal.bundesarchiv.de/video/95449/697314
Der zweite Beitrag, wieder nur ein Ausschnitt, ist einem Gespräch mit dem Chefredakteur der Literaturzeitschrift Sinn und Form, Prof. Wilhelm Girnus mit den Drehbuchautoren Wolfgang Kohlhaase und Günther Rücker gewidmet. Ab etwa Minute 21:06 des Films, siehe Link, sieht der Zuschauer ein Standbild mit dem Zitat: Nur kleine Geister halten Ordnung, Genies überblicken das Chaos. Was das wohl bedeutet, wie es bei dem/denen aussieht, frage ich mich? Ein Kamerazoom klärt auf: Buchrücken, Bücherregal, in dem die Bücher stehen oder übereinander liegen, was sich als ungünstig erweist, wenn man was sucht und das Gesuchte ganz zu unters ist. Ist dass das Chaos, vor dem gewarnt wurde? Die Kamera zoomt bis die Totale erreicht ist. Vor dem Regal am Schreibtisch auf einem Schreibtischstuhl das Genie – das sollte ich doch wohl denken – Prof. Wilhelm Girnus. Er legt Papiere zusammen, verlässt stumm damit das Zimmer. Kameraschnitt ohne Blende, Girnus betritt eine Art Wohnzimmer, in dem an einem runden Tisch bereits die Drehbuchautoren Wolfgang Kohlhaase und Günther Rücker vermutlich vom Kamerateam in Aussicht auf ein Dreigespräch über…platziert wurden. Kaum Platz genommen, ergreift Girnus das Wort, spricht über die Neuste noch unveröffentlichte Ausgabe der Literaturzeitschrift Sinn und Form. Neben Beiträgen zu Problemen des antifaschistischen Kampfes Angesichts aktueller politischer Ereignisse enthalte die Ausgabe Beiträge zur Auseinandersetzung über den Roman Kindheitsmuster von Christa Wolf. Es wird darüber gesprochen, das von ihnen als Redaktion erwartet wird, dass sie Bewertungen abgeben. Kohlhaase reagiert darauf sinngemäß wie folgt: Bewerten kann man nur Diskussionen, die man beenden will. Diskussionen, die weitergehen kann man kommentieren. Großartig, mehr gibt es dazu nicht zu sagen, aber natürlich wird weiter gesprochen. Auch Rücker ist gegen Bewertungsbefehle der Redaktion gegenüber.
Der Gesprächsverlauf ändert sich nicht mehr: Es geht um den Ton von Kritiker-Kritiker, um das Muss von öffentlicher Literaturkritik und und…
Zwischen den Zeilen: die Gesprächspartner sind sich alle von vorn herein einig und tragen ihre Argumente für Freiheit im Literaturzeitschrift-Betrieb vor. Es wirkt inszeniert, extra für den Kamerafilm für die SFD. Was fehlt, ist Widerspruch. Ist eine Kontroverse. So bleiben Mängel an Lebendigkeit als Eindruck bei mir hängen.
Dennoch empfehle ich sich den ganzen Filmporträt über Girnus anzusehen, denn er kommt mit Inhalten zu Wort, in dem er gleich zu Anfang über die Zerstörung der Natur trotz Gesetzgebungen für den Schutz der Natur spricht. Das sind doch sehr interessante, ungewöhnliche Töne.
Link zum Beitrag: https://digitaler-lesesaal.bundesarchiv.de/video/213764/685553
Das Filmporträt des christlichen Keramikkünstler Christian Richter ist von ganz besonderer Energie getragen. Schon sein Abraham Lincoln Bart ist eindrücklich. Die Ungewöhnlichkeit der Bartfrisur für unsere Zeit kommt auch in seiner Einstellung zum christlichen Glauben zum Ausdruck, der er verbal wie virtuell ausdrucksstark in Szene zu setzen weiß. Die Art wie er von seinen Überzeugungen spricht, löst Unbehagen bei mir aus. Dies ist nicht inhaltlicher Art. Es ist vielmehr mit welcher Stimmlage, mit welcher Überzeugung er davon spricht. Er scheint nicht beseelt, sondern besessen zu sein. Richter hat den Dienst an der Waffe verweigert, seine Söhne auch.
Er kämpft öffentlich gegen Aufrüstung. An einen Brett am Zaun seines Grundstück pinnt er Botschaften gegen Krieg und gegen Hunger auf der Welt, wie diesen: Unsere Welt hat Brot für alle/ Die meisten Menschen hungern./ Die Rüstung ist übersättigt/ und bedroht alles Leben./Gott will, dass wir vertrauen schaffen,/ abrüsten und furchtlos-brüderlich teilen.
Die Aushänge werden mitunter entfernt. Ich denke: Er ist laut, er hat immer was zu sagen. Er lässt sich nicht Mundtot machen. Im Anschluss an die Vorführung kommt der anwesende Sohn Oliver zu Wort. Er bestätigt, das sein Vater so war wie im Film. Also eine Rampensau (meine Worte). Wenn er anwesend war, wurden die anderen zu Statisten. Die Richters hatten ein offenes Haus. Es kam vor, das sein Vater Leute einlud und dann selbst nicht Zuhause war. Seine Mutter stand mit denen dann rum und musste aus der Situation was machen. Die Mutter musste überhaupt immer viel machen und kam zu kurz. Auch er, Oliver, kam zu kurz, und seine vier Geschwister kamen zu kurz. Der Vater hat allen verfügbaren Raum mit sich ausgefüllt, so war das. Das Leben mit ihm hatte auch gute Seiten. Eine davon dürfte sein, dass man mit den Performance des Vaters angeben konnte. Richter hatte am 13. August 1971 sich mit einem Fahrrad zu einem Blumengeschäft begeben und betreten. Nach nicht genau definierter Zeitüberlieferung verlässt Richter das Geschäft mit einem großen Blumenstrauß. Nimmt die Fahrt wieder auf, die er an der Bornholmer Brücke beendet. Steigt vom Rad ab. Nimmt den Blumenstrauß, legt ihn zum Gedenken der Mauertoten ab. Man kann sicher sein, das Richter dies unter den wachsamen Augen der Staatssicherheit getan hat. Infolgedessen saß er nämlich fünf Tage im Knast, in Berlin-Pankow. Es ist anzumerken, dass es mir unerklärlich ist, wie es überhaupt zu dem Film kommen konnte? Richter war in vielerlei Sinne kein Vorzeigebürger. Ganz im Gegenteil, er kann als subversives Element der sozialistischen Gemeinschaft eingestuft werden. Eigentlich hätte er doch gar nicht mehr frei gehört aus – Staatssicherheitssicht.
Ich fragte Oliver Richter, was aus seinem Vater nach 1989 geworden ist. 1993 hat Christian Richter seinen Standort aufgegeben und ist nach Schildow umgezogen. Nach 1990 hat keiner seiner alten Kunden mehr Keramik gekauft. Das Leben wurde anders schwer. Für den Frieden zu kämpfen hatte er nicht aufgehört.
P.S. Sein Bruder, wie er waren Bausoldaten. Oliver war in einer Chemiefabrik in Berlin Lichtenberg eingesetzt. Die Arbeitsbedingungen waren verheerend. Giftigen Sachen war er ausgesetzt. Arbeitsschutz ein Fremdwort. Aber er hatte auch von Freunden und Bekannten erfahren, das es noch Schlechteres gab.
Link zum Beitrag: https://digitaler-lesesaal.bundesarchiv.de/video/6657/691328
Gefunden-Link zum Beitrag über Christian Richter: https://www.tagesspiegel.de/berlin/christian-richter-geb-1935-2434234.html
Das vierte Porträt stellt den 70 Jahre alten Schauspieler Erwin Geschonneck vor, an seiner Seite, die 40 Jahre jüngere Ehefrau Heike Geschonneck. Sie ist seine vierte und wird seine letzte Ehefrau sein. Erwin und Heike aneinander geschmiegt, einander verbunden, einander zugewandt, das Bild ist so stark, dass ich kaum auf das gesprochene Wort höre. Vielleicht sind die Bilder auch insgesamt stärker als das gesprochene Wort. Er, Geschonneck, gefällt sich. Fällt aber nicht. Das Paar besucht die Leipziger III. Internationale Dokumentar- und Kurzfilmwoche, im November 1973. Er, er interessiert sich auch für andere Sparten. Er besucht seit Jahren das Filmfest. Er erfährt Dinge über die Welt. Er wird davon getriggert. In einem anderen Ausschnitt ist das Paar in einer Stube platziert mit Couch mit floralem Muster, einem Tisch mit Glasplatte, zwei Sesseln, einer Schrankwand, ein paar Bildern an der Wand. Das Mobiliar wirkt nicht hochwertig, nicht geschmackvoll, auch wenn das Inventar gewiss sorgsam auf einander abgestimmt wurde. Geschonneck wird zu seinem Berufsanfang befragt. Heike kommt am Ende der Befragung ihres Gattens zu Wort. Man will wissen, ob es nicht schwer ist mit einem Schauspieler zusammen zu leben? Sie verneint.
P.S. Erwin hatte den Arm um sie gelegt und immer wieder gestreichelt. Du gehörst zu mir, ich zu dir.
Link zum Beitrag: https://digitaler-lesesaal.bundesarchiv.de/video/250303/672277
Das letzte Personenporträt widmet sich Stephan Hermlin, der zur Drehzeit bis zum Ende seines Lebens in der Kurt-Fischer-Straße, in Berlin-Pankow lebte. Hermlin ist ein schöner Mann, schießt es durch meinen Kopf. Er spricht von seiner Kindheit, seiner Jugend. Er habe den Trieb in sich gespürt schon als Kind, dass was er als Schönes erfahren hat, an andere weiterzugeben. Das hat sich bis in die Gegenwart erhalten. Erzählt wird von Spannungen zwischen seinen Eltern angesichts seiner kommunistischen Überzeugung. Für seinen Vater, der es als Textilkaufmann zu Wohlstand gebracht hatte, ein Tabu. Hermlin hatte aber nicht nur Zuhause Probleme, auch in der Schule. Seine Klassenkameraden waren durchweg fast alle Nationalsozialsten, entweder aktive oder sympathisierende. Er war der einzige Kommunist auf seiner Preußischem Lehramtsschule. Ab 1931 gab es eine rechte Einheitsfront in Deutschland. Hermlin war real gesehen, der einzige Kommunist der ganzen Schule. Selbstverständlich stieß er auf eine harte Gegnerschaft. Diese Gegnerschaft sollte man aber auch nicht übertreiben, betont er. Wie es zumeist ihre Art ist, setzen sie physische Gewalt ein. Er war selbst ein guter Boxer gewesen und hat ihnen Respekt abverlangt. Es ist danach nie wieder zu derartigen Auseinandersetzungen an seiner Schule gekommen. Die Duelle faden rhetorisch danach statt. Da er viel las und sich auskannte über Marx und so, wurde er zu einer Art Autorität für seine nationalsozialistischen Schulkameraden. (Schräg) Es hatte sich merkwürdiger Weise trotz der Unterschiede eine Kameradschaft zwischen ihnen gebildet. An vielen Nachmittagen nach der Schule stand man ein paar Meter entfernt voneinander in seiner roten oder braunen Uniform und beteiligte sich am Wahlkampf, was damals zum Tagesgeschäft gehörte. Auch alltäglich war, das viele Menschen bewaffnet waren. Bewusst hätten die Kameraden aber nicht aufeinander geschossen. Allerdings könnte er nicht einschätzen, ob er bei einem Nachtkampf nicht doch…Hermlin spricht von Doppelleben, dass er führte. Auch später als ihn angesichts seiner politischen Gesinnung und seiner jüdischen Identität in die Illegalität geht, spricht er von Doppelleben. Tagsüber in einer kleinen Fabrik gearbeitet, nach „Feierabend bin ich für den Widerstand tätig“.
Hermlin wirkt bedacht und klug auf mich. Das macht ihn so besonders für mich.
Link zum Beitrag: https://digitaler-lesesaal.bundesarchiv.de/video/697493/695807
Anna Barnert wurde gefragt vom Publikum, wie sie eigentlich auf die Filme der Staatlichen Filmdokumentation der DDR aufmerksam wurde. Als hätte man sie bei etwas erwischt, teilt sie dem Publikum mit, dass sie eigentlich nach was anderem recherchiert hat. In diesem Zusammenhang tauchte aber immer wieder ein Verweis auf die Staatlichen Filmdokumentation (SFD) der DDR auf. Irgendwann reichte ihr und sie folgte den Hinweisen auf die SDF. Um so mehr sie darüber in Erfahrung brachte, um so größer wurde ihr Wissensdurst. Und natürlich wuchs wurde ein unbändiges Bedürfnis in ihr groß, die SFD und deren Produkte wissenschaftlich zu bearbeiten. Ihre wissenschaftliche Arbeit „gipfelte“ in der Veröffentlichung des Buches Anne Barnert | Filme für die Zukunft, daran angelehnt auch die Veranstaltungsreihe Was von der DDR bleiben sollte, des Zeughauskinos ist.
Abschließend kann man festhalten, Anna Barnert ist durch Zufall dazu gekommen. Aber gibt es Zufälle für Lebensentscheidungen?
Ich bin mächtig froh, dass ich daran Anteil nehmen konnte. Danke Wissenschftler*innen, Danke Zeughauskino.

15.06.2025 Volksbühne
Wachs oder Wirklichkeit, Regie Christoph Marthaler, eine Frau mit Staubwedel spricht wiederholt die Worte: Nicht einschlafen. Ich strenge mich an, es nicht zu tun. Ein Panoptikum mit Wachsfiguren und echten Menschen versammeln sich auf der Theaterbühne. Das Bühnenbild, aufwendig – gut gemacht, eine Art Jugendstil-Foyer über zwei Stockwerke mit Treppe, obere Balustrade, Mobiliar. Promis wie Heino, Lady Diana (habe ich nicht erkannt), Karl Lagerfeld, eine Lady in silbernen Cowboy-Stiefel mit sehr guter Gesangsstimme – gespielt von Tora Augstad, The Queen, Horst Lichter, Einstein und ? werden soweit sie tatsächlich aus Fleisch und Blut sind lebendig, um zu anderer Zeit erneut zu erstarren. Ich vermerke, gemächliche Bewegungen. Die Sätze der Protagonisten zerfallen in immer die selbe Art Phrase: Erst bejahen, dann das Bejahte negieren. Geht es nur um die Wahrnehmung, echt oder unecht? Und wenn ich das positiv beantwortet habe, was kommt dann? Säße ich nicht in der Mitte, sondern am Rand, hätt ich die Vorführung vorzeitig verlassen. Ergebe mich in mein Schicksal, sitze fest, warte. Der Vorteil ist, dass ich innerhalb des Stücks, dessen tiefen Sinn ich anzweifle, alle Musikbeiträge, die nicht wenige sind und mir gefallen, nicht verpasse. Erholsam die parallel erzählte Geschichte des Klein H in Pankow Süd, die mit verteilten Rollen vor dem eisernen Vorhang in drei Akten als szenische Lesung dargeboten wird. Der Handlung ist leicht zu folgen: Herr H hat in Berlin Wohnungen zu vermieten. Er verlangt zu viel Geld dafür. Die Mieter können das nicht mehr bezahlen. Er wird nach Berlin eingeladen. Man verständigt sich, dass Herr Ernst eine Falle stellt, so dass er zu Tode kommt. Der Roboter, der sich als Waffenlieferant und bewährter Folterknecht anbietet, geht Herrn Ernst zur Hand. Der Text für diesen Einschub entstammt Jürg Lüderachs Stück Hitler in Pankow South. Da bin ich nicht im Bilde.
Überhaupt scheine ich über vieles nicht im Bilde zu sein, was auf dieser Bühne unter dem genannten Titel stattfindet. Nachträglich lese ich in den Gazetten, das eigentlich Sophie Reus hätte mitspielen sollen, aber wegen Krankheit ausfiel. Hätte das was verändert?

14.06.2025 Atelier
Beschäftige mich mit dem Hintergrund des Bildes mit Jogger.

13.06.2025 Zeughauskino, Reihe: Was von der DDR bleiben sollte (Siehe auch 23., 24. und 27.05.2025)
Der vierte Abend der Reihe: Was von der DDR bleiben sollte, steht unter dem Thema Wohnen. Gezeigt werden Beiträge über Arbeiter-, gesperrte und illegale Wohnungen: Berlin-Totale III. Lebens- und Wohnverhältnisse 5. Wohnkultur b) Arbeiter-Wohnung, DDR 1978, Dokumente zur Lebensweise. Wohnungsprobleme 1982/83 – Dokument II. Gesperrter Wohnraum, DDR 1982-1983, Berlin-Totale III. Lebens- und Wohnverhältnisse 5. Wohnkultur e) Arbeiterwohnung (II), DDR 1979, Dokumente zur Lebensweise. Wohnungsprobleme 1982/83 – Dokument I, DDR 1982-1983. Anne Barnert, Wissenschaftliche Mitarbeiterin im Forschungsverbund Diktaturerfahrung und Transformation und Autorin der Publikation „Filme für die Zukunft, führt durch den Abend.
Im ersten Film wird die Familie Ullrich in Berlin-Marzahn vorgestellt. Die Ullrichs sind vor kurzem in die Neubauwohnung, in Marzahn eingezogen. Sie haben sich vergrößert von einer 1-Raumwohnung zu einer 2-Raumwohnung. Das ist nicht ideal mit zwei Kindern, aber vorerst erträglich. Irgendwann wollen sie aber eine 3-Raumwohnung beziehen, damit sie nicht mehr, wie jetzt, im Wohnzimmer schlafen müssen. Die Wohnung hat fließend Wasser und Fernwärmeheizung. Kritik gibt es an der Bauweise. Herr Ullrich weiß zu berichten, dass sich der eingezogene Spannteppich im Wohnzimmer anhebt, sobald der Wind auf der Fensterwand steht. Da wo die Betonplatten aufeinander treffen, sind die Fugen nicht dicht. – So Herrn Ullrichs Vermutung. Durch die Mängel gelangt der Windzug unter den Teppich, hebt ihn an. Er ist eingerissen, da wo die Sofabeine aufliegen.
Im zweiten Beitrag wird ein Paar in seiner Wohnzimmercouchsituation porträtiert, die in einer 3- Zimmer-Arbeiteraltbauwohnung mit 96 m2 leben. Sie erzählen von der maroden elektrischen Leitung, wodurch es in zwei Zimmern keinen Strom gibt. Das Bad ist ohne Waschbecken ausgerüstet. Da laut Bauplan noch nie ein Waschbecken dort vorhanden war, lehnt die Kommunale Wohnungsverwaltung (KWV) es ab, eines einzubauen. Bzgl. der Mängel der Elektrik sagt die KWV, dass die Elektrik komplett erneuert werden müsste, wofür kein Geld da ist. Deswegen lässt man es sein. Bilder der Räume mit Schadstellen zeigt die Kamera nicht.
Ebenfalls in dem Beitrag wird die Familie Miersch, in Am Friedrichshain 9, vorgestellt. Die Kamerafahrt führt den Zuschauer vor das Haus, in den Hausflur, in die Wohnung. An einer der Wände im Flur „thront“ ein auffällig großer dunkler Fleck: Nässe, Schimmel? Weiter geht es in die Küche, wo die Kamera einen kaputten Fensterrahmen und eine seltsame Deckenleuchtkonstruktion ins Bild nimmt. Das Elternschlafzimmer hat zwei Türen. Vor einer der Türen steht eine Kommode. Der Raum drückt Platzmangel aus. Es gibt einen Balkon, im Bad eine Badewanne. Das Wasser wird mit einer Gastherme erhitzt. Nicht alle Wände sind verputzt. Ein Junge sitzt in der Küche, zeichnet. Den Straßenlärm, den der Kameraton beim filmen aufnimmt, nehme ich als Lärm wahr. Die Familie wird nur beobachtet, nicht interviewt.
Zu sehen unter Link: https://digitaler-lesesaal.bundesarchiv.de/video/9583/684136
Der Film Wohnungsprobleme 1982/83 – Dokument II. Gesperrter Wohnraum lässt die Familie Otto zu Wort kommen, die in einer gesperrten Altbauwohnung leben. Herr Otto, Jahrgang 1944, ist in Berlin-Johannisthal wohlbehütet aufgewachsen. Kennt dadurch viele Menschen in seiner Wohnlage. Er arbeitet in drei Schichten. Frau Otto stammt aus Mecklenburg, lebt seit 14 Jahren hier. Die Ottos leben in einer 2,5 Zimmerwohnung mit 72 m2 zu dritt. Frau Otto arbeitet in der dritten Schicht als Aufpackerin, in der Kaufhalle Flutstraße. Eigentlich ist sie Melkerin, aber das wird in Berlin nicht verlangt. Sie hat ihren Fachverkäufer nachgemacht. Ihre Arbeit macht ihr Spaß. Das Thema Wohnung bezeichnet sie als Albtraum: Die Regenrinne fehlt, es regnet in der Küche rein. Wenn Beide zur selben Zeit Nachtschicht haben und es regnet, fährt sie zwischendurch nach Hause und stellt diverse Gefäße auf. Eine gute Stunde mit Wegezeit braucht sie dafür. Die Fehlzeit muss sie nacharbeiten. Die Wohnung über ihnen ist längst leergezogen wegen des undichten Dachs. Und in Ottos Wohnung war auch schon das Bauamt. Die Decke der Küche wurde geprüft und daraufhin gesperrt. Alles sollte raus. Frau Otto kochte vorrübergehend bei der 79 Jahre alten Nachbarin. Da das kein Dauerzustand war, sie die alte Frau wegen ihrer Schichtarbeit auch Abends belästigten, räumten sie ihre Küche wieder ein. Eines Tages besucht sie Frau Günther vom Amt, strahlt über das ganze Gesicht. Sie habe eine Wohnung in Marzahn für die Familie. Das Ehepaar guckt sich einander an, lehnt ab. Sie wollten in der Gegend bleiben. Nach Marzahn, never ever. Sie müssen was unterschreiben, dass sie das Angebot ablehnen. Etwas später empfiehlt ihr das Amt, wenn sie in Johannisthal eine leerstehenden Wohnung findet, solle sie das melden. Ist darunter eine geeignete Wohnung für die Familie Otto, bekommen sie die zugesprochen. Frau Otto hat sich umgeguckt, Leerstand gemeldet, aber nie eine dieser Wohnungen zugesprochen bekommen. Jetzt sucht sie nicht mehr.
Zu sehen unter Link, ab Minute 20:57 min: http://digitaler-lesesaal.bundesarchiv.de/video/6664/697309
Der letzte Beitrag ist zwei allein erziehenden Mütter gewidmet, die in einer illegalen Wohnung leben. – Die Wohnungen liegen entweder in Abrissgebieten oder in langfristig geplanten Rekonstruktionsbauabschnitten, erklärt eine Interviewpartnerin vom Amt. Die Wohnungen, die wieder hergestellt werden sollen, seien teils leergezogen, teils aber noch bewohnt. Im Falle des Beitrages sind die Wohnungen im Vorderhaus belegt, im Hinterhaus (HH) nicht. Im HH hat eine Frau, hochschwanger im 1. Stock eine Wohnung bezogen. Sie ist polizeilich gemeldet und zahlt eine Art Miete. Ihre Nachbarin, ebenfalls eine Illegale, wohnt ebenfalls mit Kind im HH. Keiner der Nachbarn hat etwas dagegen gesagt, nur der Herr Lot. – Er führt das Hausbuch. Illegalen Bewohnern verweigert er den Eintrag darin. Der ersten Frau ist das egal. Sie lebt schon vier Jahre in der Wohnung.
Ein Gespräch zwischen Moderator der Staatlichen Filmdokumentation der DDR, den zwei illegalen Bewohnerinnen und Herrn Lot wird von der Kamera erfasst. Herr Lot beharrt auf seiner Meinung. Wer keinen Einweisungsschein vom Wohnungsamt vorlegen kann, der kann nicht in das Hausbuch eingetragen werden. Er ist ein Mann mit beschränkte Denkweite, ein dummer Mensch, unsympathisch, ein Dietrich Hessling, ein Karteikartenreiter, der Fähnchen hinterher rennt, wenn es die Zeit – den Mächtigen schmeichelt. Er will schließlich alles richtig machen. So einem kann man das nicht vorwerfen, aber man will so einen auch nicht in der Nähe haben. Lot berichtet, dass er selbst in einer der gesperrten Wohnungen in der 1. Etage lebte. – Dass er früh 13, Mittags 13, Abends 8 Kohlen zu legte in den Ofen: Im Bett musste er das Essen zu sich nehmen, so kalt war es. Aus diesem Grund wurde die Wohnung gesperrt. Nie wieder würde er dort leben wollen. Jetzt lebt eine der Frauen mit einem Kind dort. Sie hätte nicht einziehen dürfen. Wieso hat sie keinen Antrag auf Wohnraum gestellt, fragt er? Hat sie, aber der wurde nicht angenommen, weil sie nur schwanger war. Das Kind im Bauch sei noch kein Beweis. Das könnte sie noch verlieren. Mit dem Kindsvater war sie im Streit, lebte bei einer Freundin. Sie dachte über Alternativen nach. Es gab nur die eine, eine. Der Zuschauer ist auf ihrer Seite.
Zu sehen unter Link: http://digitaler-lesesaal.bundesarchiv.de/video/6664/697309
Ich notiere Gegebenheiten, registriere aber auch Utensilien der Wohnungen, die ich aus meinem eigenen DDR-Wohnleben kenne. Wohnungen mit hinfälliger Bausubstanz erinnere ich nicht in meinem kleinen Harzer Städtchen Nordhausen. Meine Mutter erzählte mir in ihrem Sterbejahr von einem Wohnungsangebot durch einen Arzt ihrer Betriebsstelle. Die Wohnung befand sich in einem Hinterhof. Man gelangte über eine Hühnerleiter vom Hofhinein. Es gab zwei Durchgangszimmer. Kein Wasser. Sie lehnte empörend ab, mit Baby und Kleinkind dort einzuziehen. Wenig später ist sie durch gute Umstände in die Geseniusstraße 22, eine Mansardenwohnung, illegal eingezogen.
Ich mochte es dort zu leben. Auf den nebenan liegenden Dachboden konnte ich vorzüglich spielen. Er roch nach alten, trockenen Holzbohlen und Staub. Dieser Geruch begegnet mir in den Häusern von Heute leider nicht mehr. Das meine Mutter im Sommer das Wasser für die Toilettenspülung aus der Zorge schöpfen musste, weil der Wasserdruck nicht ausreichte, trübt mein Kinderbild nicht.
12.06.2025 Stiftung Starke
Brigitte Bardot und ich besuchten die Vernissage der Sommerausstellung der Stiftung Starke, deren Hauptsitz das Löwenpalais ist. Die Villa ist im neobarocken Stil 1903 vom Architekten Hans Sehring erbaut wurden. Dort zu leben, würde ich nicht ablehnen. Ich traf Josephine Riemann, Peter Schlangenbader, Catherine Bourdon und Corina Rosteck. Mit Corinna unterhielt ich mich etwas länger über den Stand ihres Projekts IN TRANSISTION FROM PERFORMANCE TO EXHIBITION, an dem ich beteiligt bin. Weil alle Förderanträge negativ ausfielen, musste sie einige Anpassungen tätigen. Corinna schwärmte von der Bereitschaft einiger Performer, die auch ohne Gage am Projekt teilnehmen. Jeden Samstag soll es einen Event geben. Okaaaayyyyy. Ich erzählte ihr von der Performance EIRENE von Rosiak Jankó-Glage. Ich darf ihr das Video schicken.

9.06.2025 Deutsche Historische Museum und Zeughauskino
Den Pfingstsonntag nutzen Brigitte Bardot und ich dazu uns die Ausstellung Gewalt ausstellen anzusehen, im Deutschen Historischen Museum. Die Ausstellung beschäftigt sich mit der Sicht auf die Ausstellungen, die die Gräueltaten des NS-Regimes in den Fokus ihrer Ausstellungen nahmen, im Zeitraum von 1945-1948. Sie wurden in vielen europäischen Ländern von Institutionen, Gruppierungen und Akteuren ganz unterschiedlicher Herkunft organisiert. Die Ausstellungen zielten darauf ab, die Auswirkungen des Holocaust und der nationalsozialistischen Verbrechen für die Zivilbevölkerungen zu dokumentieren und zu visualisieren. Frühere Ausstellungen in London, Paris, Warschau, Liberec und Bergen-Belsen werden dokumentarisch und chronologisch, in schwarz/ weiß auf großen Texttafeln mit Bildern präsentiert – streng voneinander abgegrenzt nach den damaligen Ausstellungsorte und Nationen.
Die Präsentation erinnert mich an die Besuche in meiner Kindheit des KZ Lager Dora, Nordhausen, das ähnlich trocken aufbereitet war und bald überdrüssig wurde. Wenn ich nicht auf das Hintergrundwissender Filmreihe: Bezeugen und erzählen, des Zeughauskinos zurückgreifen könnte, würde ich in der Ausstellung ganz schön ins schwimmen kommen.
Was ich mitnehme, dass es eine übereinstimmende Ablehnung gegenüber den Opfern des Holocaust gab. So versäumten die Ausstellungsmacher es vorsätzlich, möchte ich behaupten, der jüdischen Opfergruppe eine sichtbare und angemessene Stimme zu geben. Ausnahme war die Ausstellung in Bergen-Belsen, die aber wurde von der Jüdische Kommission organisiert. Betrüblich, Nachdenkens Wert.
Ich werde die Ausstellung nochmals besuchen, aber diesmal eine Führung mitmachen.
Die Abendveranstaltung, ebenfalls am gleichen Standort, Zeughauskino im Deutschen Historischen Museum:
Der Spielfilm Hinter Klostermauern, D 1952, handelt von Thomas Holinka, einem Mann, der seine Zeit und sein Geld für seine Spiel- und Trinksucht aufwendet. Holinka ist gerade aus dem Gefängnis entlassen, sucht als Erstes seine Freundin Kathrin auf. Die wohnt aber nicht mehr unter der Adresse. Aus Armut lebt sie seit langem mit dem unehelichen Sohn in einer baufälligen Hütte nahe der Kiesgrube. Holinka sucht sie dort auf, lebt mit ihr dort. Verspricht ihr, dass er etwas besseres für sie findet. So wendet er sich ans Amt, aber wegen seiner Vorstrafen und seiner aufbrausenden Art wird er abgewiesen. Bei einem seiner Streifzüge entdeckt er im Umland ein leerstehendes Kloster, in dem er sich nebst Familie im Kloster einquartiert. Eines Tages tauchen Beamte des Bauamts auf, die die Räumung des Klosters verlangen. Sie kündigen die Rückkehr der Hausherrinnen an. Holinka weigert sich. Die Polizei kommt. Er stellt sich breitbeinig vor ihnen auf. Es kommt zum Streit. In dem Moment treffen die Nonnen ein. Die Oberin bittet die Polizisten zu gehen. Sie würde die kleine Familie vorerst im Kloster dulden. Sie lässt sich von seiner ruppigen Art nicht einschüchtern. Glaubt an das Gute im Menschen, so auch an ihn. Für diese Einstellung hat Holinka nur Hohn und Spott übrig. Nicht alle Klosterfrauen sind mit ihrer Entscheidung einverstanden. Vor allem die Subpriorin erinnert daran, dass Christus „die Schänder seines Tempels mit der Peitsche rausgetrieben“ habe. Sie ist es später auch, die über die widrigen Umstände im Kloster der Generaloberin Meldung macht usw.
Die Essenz des Films: Die Oberin wird geprüft und Holinka wird geprüft. Als alles schon gut und final war, gibt es eine Wendung, mit der ich nicht rechnete: Obwohl Holinka schon auf dem Weg der Läuterung war und einer Arbeit nachging, geriet er auf Abwege. Er lässt sich überreden zu trinken und gegen Geld Karten zu spielen. Ein Teil des Geldes gehört dem Kloster. Nur der Zuschauer weiß, dass Holinka durch sein Verhalten die Position der Oberin gefährdet. Doch dann kommt ein Betrug beim Kartenspiel ans Licht und Holinka bekommt sein Geld zurück. Die Oberin und alle Nonnen glauben nun noch mehr an das Gute im Menschen.
Die Schauspieler (Oberin) Olga Konstantinowna Tschechowa, (Holinka) Frits van Dongen, (Kathrin) Katharina Mayberg und (Nonne) Margarete Haagen kamen mir bekannt vor.
8.06.2025 (Künstler(Gespräch) im VBK
Mit Brigitte Bardot war ich beim (Künstler)Gespräch der Ausstellung Oma, Opa und das Böse in uns, in der Galerie VBK. Der Projektleiter und Moderator Steffen Blunk saß auf einem Heizkörper, alles überblickend, während wir anderen im Stuhlkreis Platz genommen hatten. Nicht alle bereitgestellten Stühle waren besetzt.
Statt einen Rundgang durch die Ausstellung zu machen, wie ich es erwartet hatte, (ver)führte uns Steffen zu einem Gespräch über das Böse im JETZT. Schweigen, warten. Das Böse in uns…, in jedem schlummert das Böse, es gehört zum Menschen. Nur ist das Böse dann, wenn es einen Dritten in seiner Freiheit oder gar seinem Leben beschränkt, gar vernichtet ein wirkliches Böses. Die anwesende polnische Jüdin und Künstlerin Halina Hildebrand erzählt von ihrer Annäherung der Familienchronik ihres Mannes Ralph, die einige Nazinationalisten hervorgebrachte. – Die Gott sei Dank möchte ich sagen, im Krieg gefallen sind. Welche Haltung hätten ihre toten Verwandten eingenommen, angesichts dessen, dass sie mit einem Tätersohn das Bett teilt?
Eine andere Frau, Polin, aus Danzig, erzählte, dass sie sich schon lange mit dem Matriarchat befasst. Das Patriarchat macht sie für die sozialen Missstände und moralischen sowie psychologische Haltungen und Zwänge verantwortlich. Das Matriarchat ist älter. Es hat 3000 Jahre vor Christus lange zuvor erfolgreich existiert. Es gab Teilhabe und Frieden. Werte, die in patriarchalen Strukturen nicht vorkommen, weil sie durch und durch kapitalistischer Natur. Das fand ich einen interessanten Gedanken. Sie erzählte noch, das ein befreundeter Freund die AFD wählt, obwohl er schwul ist. Er sagt sich, lieber von den Rechten ermordet werden, als von den Islamisten. Die Islamisten seien viel schlimmer. Er wollte nicht gesteinigt werden.
Ich hatte selbst kurz überlegt, ob ich mich bewerbe. In meiner Familie ist das Böse die Rote Armee, die durch die Haltung meiner Mutter auch mich geprägt hat.
Es ist doch so, dass man als Nachkomme gar keine Wahl hat, wen man mag, wen nicht. Oder doch?
27.05.2025 Zeughauskino, Reihe: Was von der DDR bleiben sollte (Siehe auch 23.und 24. 05.2025)
Der dritte Abend der Reihe: Was von der DDR bleiben sollte, steht unter dem Thema Gesundheit und Medizin. Vorgeführt wurden Ausschnitte aus: Klinikum Buch – Gespräche in einer strahlentherapeutischen Klinik, DDR 1984/ Exil, DDR 1985/ Helmut Kraatz, Prof. Dr. sc. med. (geb. 6.8.1902 in Wittenberg)/ DDR 1972. Begleitet wurde die Vorführung durch Anne Barnert, Wissenschaftliche Mitarbeiterin im Forschungsverbund Diktaturerfahrung und Transformation und Autorin der Publikation „Filme für die Zukunft. Die Staatliche Filmdokumentation am Filmarchiv der DDR“.
Zuallererst die Information, dass es nur wenig Material zu dem Thema gibt. Zudem wurden die Filme bis auf Aufnahmen des Films Exil nicht in Behandlungs- bzw. Patientenzimmern gedreht. Die Tonqualität ist bescheiden, nun. Die Interviewten versteht man aber ausreichend gut. Die Aufnahmen entstanden innerhalb von zwei Jahren, wodurch eine zwischen Filmteam und Personal eine Vertrautheit und Akzeptanz entstand. Das merkt man den Interviews an.
Der Abend beginnt mit Akademie für Ärztliche Fortbildung der DDR/ Gespräche in einer Strahlentheurapeutischen Klinik, DDR 1984 von Hans Wintgen
(Link: https://digitaler-lesesaal.bundesarchiv.de/video/343739/667647) Der Chefarzt sitzt hinter dem Schreibtisch, referiert über den eigenen Anspruch seiner Klinikarbeit. Der Patient soll im Mittelpunkt des Geschehens stehen, so sein Plädoyer. Räumt dabei aber ein, dass er als Chefarzt lediglich für die Organisation, der Durchführung und der Einhaltung seines Anspruchs verantwortlich ist, sich selbst aber dem damit verbundenen Leid des Stationsalltags – dem Sterben – nicht aussetzen muss: Fünf Minuten bei der Visite, ein Blick in die Krankenakte, ein paar medizinische Worte, den Patienten dabei nicht ansehend, und weg. Das ist möglich. Er weiß, dass sein Personal seine „Kacke“ wegmacht“ und das es schwer ist. Deswegen sorgt er dafür, dass das Personal geschult wird. Er kennt die 5 Sterbephasen nach Elisabeth Kübler-Ross, auch wenn er nicht direkt auf sie Bezug nimmt.
Der Filmausschnitt Exil stellt uns einen chilenischen Exilanten vor, der im Zuge des chilenischen Militärputsch 1973 über Argentinien, in die DDR mit seiner Familie einreiste . Die ersten drei Jahre ist er mit seiner Band in der DDR aufgetreten und hat Lieder des Widerstands vorgetragen. Die Band löste sich auf. Er ging in seinen alten Beruf, als Kieferchirurg. Bildete sich weiter und übernahm eine leitende Tätigkeit. Obwohl in der DDR weitergebildet und Karriere machend, wünschte er sich eine Rückkehr in sein Heimatland. Sicher ist er irgendwann, als es für ihn ungefährlich wurde, zurück nach Chile gegangen. Aber das wird im Film nicht erzählt.
Zweite Sequenz des Films, die Ärztin, die nicht gut heißt, dass man Patienten eine Zeitprognose stellt. Der Beitrag steigt ein mit der Überschrift: Der Arzt ist schlecht vorbereitet auf sein Leben, er kennt zwar die Diagnosen, er kennt die Medikamente, er kann die Todesursache feststellen, aber von der menschlichen Seele, weiß er überhaupt nichts“. Sie räumt ein, dass sie nicht weiß, ob sie es für sich selbst wissen würde wollen. Aufrichtig, ihre Äußerungen über Sterbehilfe. ….Wenn man vor so großen Entscheidungen steht, ob sie beruflich oder privat sind, sind sie letztlich immer allein. Da müssen sie sich immer erstmals auf sich zurückziehen und dann einen Kern rausbilden. Viel helfen kann die Gesellschaft auch nicht. Sie sind immer allein. Wenn ich mir vorstelle, ich bin Gynäkologin und weiß ich muss ein Kind entbinden im Wissen, das die Mutter oder das Kind stirbt… das ist eine ethische Frage. Heute tötet man das Kind. Das ist geregelt, aber dennoch ist der Arzt mit dieser Entscheidung allein.
Die dritte Sequenz wird eingeleitet mit dem Zitat „…auch hinterher dazu stehen und helfen muss, die Zeit, die zu leben bleibt, doch noch irgendwo lebenswert zu machen.“ Ich würde nie einem Kranken etwas geben, um sein Leben zu beenden, sagt nun die dritte Interviewpartnerin, am Kittel erkennbar, eine Ärztin. „Vielleicht hat man als Deutscher in der Richtung sehr viele Skrupel und es bleibt irgendwo immer noch eine gewisse Unsicherheit. Aber ich würde in solch einem Falle, nichts mehr tun, um das Leben zu verlängern… kann ich, wenn der Patient eine Pneumonie bekommt mit 40 Fieber entscheiden, ob ich ihm ein hochwirksames Antibiotika verabreiche und diese Pneumonie noch mal bekämpfe oder, ob ich es sein lasse? Das kann ich entscheiden und das würde ich, glaube ich…da könnte ich mir vorstellen, das wird auch getan, ich mache jetzt keine antibiotische Behandlung mehr oder ich unterlasse sie…aber aktiv das Leben beenden, in dem ich ihm was gebe, dazu habe ich einfach zu viele Skrupel. Obwohl der Unterschied zwischen den beiden Handlungsweisen gar nicht so sehr groß ist. …es ist ein Unterschied, beenden oder erleichtern…“
Die Themen der Interviewpartner sind zeitlos, ihre Aussagen berührend. Stellung und Ansehen der Personen spielen keine Rolle. Es geht schließlich um den Tod, da verstummen wir kümmerlich.
25.05.2025 Künstlerhof Frohnau
Heute meine Arbeiten der Offenen Ateliers Reinickendorf (Siehe auch 11.05.2025) bei Rosika Janko-Glage abgeholt. Ehe ich nach Hause fuhr, machten wir einen Spaziergang um den Hubertussee. Herrlich. Das tat gut.

24.05.2025 Zeughauskino, Reihe: Was von der DDR bleiben sollte (Siehe auch 23.05.2025)
Der zweite Abend der Reihe: Was von der DDR bleiben sollte, steht unter dem Thema FAMILIE. Vorgeführt wurden Ausschnitte aus: Dokumente zur Lebensweise. Formen des Zusammenlebens: Unverheiratete Partner mit Kind, DDR 1982/ Dokumente zur Lebensweise. Frau Reichardt – Kinderreich 1982, DDR 1982/ Familienbilder. Beobachtungen in einer Berliner Arbeiterfamilie, DDR 1984/ Berlin-Totale III. Lebens- und Wohnverhältnisse 2. Altbaugebiet Berlin-Mitte a) Gesellschaftliche Probleme, DDR 1979
Die Filme dokumentierten unterschiedliche Familiensituationen. Auch wenn es wegen der hohen Scheidungsrate in der DDR viele alleinerziehende Elternteile gab, wurden nur Paare gefilmt. Diese lebten unverheiratet in eheähnlicher Gemeinschaft mit zwei Kindern, lebten obgleich geschieden mit dem gemeinsamen Kind und dem neuen Partner der Exgemahlin, lebten seit 50 Jahren in einer Liebesehe, zumindest für den Mann. Sie liebt ihn nicht, denke ich. Sie ist sich dessen gewiss, dass sie sein Leben, nicht das ihre gelebt hat. Während seiner langen Abwesenheit wegen Kriegsdienst und Kriegsgefangenschaft hat sie die zwei gemeinsamen Kinder durch den Krieg gebracht und als er heimkehrte, auch die zwei neuen Kinder versorgt neben denen, die schon da waren und natürlich ihn Liebe war für sie Arbeit.
Etwa bei Minute 28 ist der Ausschnitt mit dem Ehepaar zusehen, Link: www.BArch 44972_1_Familienbilder_Beobachtungen – Digitaler Lesesaal (bundesarchiv.de)
Interessant waren auch die Aussagen zu den Wohnverhältnissen, die z.T. haarsträubend waren, wenn ein Kind berichtete, dass es in einer 2,5 Altbauwohnung lebt zu fünft, wobei der Vater, da die Eltern geschieden sind, ein Zimmer für sich allein beansprucht. Das Gegenteil gab es auch, zu dritt, in sieben Zimmern. Am 13. Juni gibt es einen Abend in der Reihe, der sich mit Wohnen beschäftigt, da werden noch ganz andere Realitäten zur Sprache kommen.
Anne Barnert, Wissenschaftliche Mitarbeiterin im Forschungsverbund Diktaturerfahrung und Transformation und Autorin der Publikation „Filme für die Zukunft. Die Staatliche Filmdokumentation am Filmarchiv der DDR“ und Andreas Kötzing, Historiker, Kurator und Autor sowie Wissenschaftlicher Mitarbeiter am Hannah-Arendt-Institut für Totalitarismusforschung in Dresde führten durch den Abend.
23.05.2025 Zeughauskino, Reihe: Was von der DDR bleiben sollte
Fühle mich schon recht heimisch im Zeughauskino, die Heute mit der der Reihe Was von der DDR bleiben sollte ein neues Vorführprogramm eröffnet. Die Reihe beschäftigt sich mit Dokumentarfilmen der Staatlichen Filmdokumentation, kurz SFD, die in den Jahren 1970 bis 1986 wirkte. Die SFD produzierte über 300 Filme, die jedoch nie für die Öffentlich gedacht waren. Die fertigen Filme wurden postum nach Fertigstellung dem Staatlichen Filmarchiv übergeben und eingelagert. Dort sollten sie in den Magazinen 30 oder gar 100 Jahre überdauern, um den Filmemachern und Wissenschaftlern als Anschauungs- und Quellenmaterial zur Verfügung zu stehen. Ihr Auftraggeber war die Hauptverwaltung Film des Ministerium für Kultur. Der Kulturführung schien es dringlich, das Leben im Sozialismus zu dokumentieren, möglichst die gesamte Gesellschaft. Persönlichkeiten oder Handwerke und Gebräuche sollten filmisch festgehalten werden bevor sie sterben bzw. nicht mehr ausgeübt werden. Das galt auch für Gebäude und Straßen, ehe sie „zusammenbrachen“. Die meisten Filme wurden in Berlin gedreht. Für die anfänglichen Visionen standen weder das notwendige Material noch das Personal zur Verfügung. Man schlängelte sich so durch. Machte das Beste draus. Der Führungsanspruch der SED war hoch, und unrealistisch. Die Filmemacher waren nicht ausgebildet. Es gibt keine Regieanweisungen, die Filme sind nicht kommentiert.
Anne Barnert, Wissenschaftliche Mitarbeiterin im Forschungsverbund Diktaturerfahrung und Transformation und Autorin der Publikation „Filme für die Zukunft. Die Staatliche Filmdokumentation am Filmarchiv der DDR“ und Andreas Kötzing, Historiker, Kurator und Autor sowie Wissenschaftlicher Mitarbeiter am Hannah-Arendt-Institut für Totalitarismusforschung in Dresde führten durch den Abend.
Der heutige Abend stand unter dem Schlagwort ARBEITSWELT. Vorgeführt wurden: VEB Elektrokohle Berlin. Brigade „Fritz Heckert“. Sequenzen einer Umgestaltung 1982-1984, DDR 1982-1984/ Berlin-Totale VI. Stadttechnik 1. Müllbeseitigung a) Hausmüll, DDR 1978/ Berlin-Totale V. Handel, Versorgung und Dienstleistungen 7. Dienstleistungen a) Gebäude- und Fassadenreinigung, DDR 1978/ Karl Mewis. geb. 22.11.1907 in Hannoversch Münden. Mitglied des ZK der SED, DDR 1973
Die Beobachtung des arbeitenden Menschen und das Umfeld der Produktionsstätte, in denen sie tätig waren, stand dabei im Vordergrund. Insbesondere der Film VEB Elektrokohle Berlin. Brigade „Fritz Heckert“ zeigte, unter welch unglaublich schlechten Arbeitsbedingungen die Arbeit verrichtet wurde, in der DDR. Der VEB Elektrokohle war auf dem Stand vor dem 2. Weltkrieg und so standen die Arbeiter regelrecht im Dreck, den sie in vollem Umgang einatmeten. Es machte mich sprachlos, dass 1984 so eine Produktionsstätte noch in Betrieb war.
In etwa 50 % der SFD Filme kamen manchmal Funktionäre zu Wort. In der Programmbeschreibung heißt es: Mit unverstellter Offenheit, etwa wenn der ehemalige Rostocker Bezirkssekretär Karl Mewis auf die Kollektivierung der Landwirtschaft in Mecklenburg zurückblickt und erzählt, welcher Zwang und Druck seitens der SED angewendet wurde, um die Bauern zu `überzeugen‘ .“ Karl Mewis war tatsächlich sehr unverstellt während des Interviews. Er schien Stolz auf sein forsches Vorgehen zu sein.
Dem voraus ging die Verkündung Walter Ulbrichts zur Vollkollektivierung, die etwa 20% der DDR Bevölkerung betraf. Die Kollektivierung stand unter einer Kampagne der SED, der sogenannten Kampagne Sozialistische Frühling. Mewes war überzeugt, dass die Kollektivierung notwendig und richtig ist. Man kann aber auch herauslesen, dass er so forsch vorgegangen ist, nach dem er vom ZK der SED gerügt wurde.
Wissenswertes: Alle Filme der SFD sind online zugänglich.
Toller Abend.

22.05.2025 Atelier
Male an dem Jogger, in gewohnter Arbeitsperspektive, 180 Grad gedreht.

21.05.2025 Aktionstag #KulturBrauchtRaum
Die AG Aktionen & Spektakel im Aktionsbündnis #BerlinIstKultur rief aus Protest gegen die Kürzungspolitik des Berliner Senats zur künstlerischen Arbeit im öffentlichen Raum nahe der Kulturverwaltung auf: Zwischen 12 und 17 Uhr waren Künstler aller Sparten eingeladen, auf der Brunnen- Ecke Veteranenstraße zu proben, zu musizieren, zu konzipieren, zu schreiben, zu malen, zu zeichnen, zu kochen… kurz um, ihrer Arbeit nachgehen.
Ich war da und habe auch erstmals die Gelegenheit genutzt im Volkspark am Weinbergsweg zu zeichnen. Auf dem Heimweg legte einen Stopp ein und zeichnete noch das, sich im Umbau befindliche Haus der Statistik. Na ja, den Teil, der nicht durch den Werbeaufsteller von Microsoft für mich verstellt wurde.
Beim Verlassen des Parks bin ich auf die Bürgerinitiative We make the Wiese green again getroffen, die bunte Stofffähnchen platzieren, wo Müll liegen geblieben ist. Hinter den verschiedenen Farben der Fähnchen verbirgt sich ein Code, der mit der Stärke der Umweltverschmutzung in Zusammenhang steht. Um so größer der Schaden für die Umwelt, um so dunkler die Farbe des Fähnchen. Schwarz markiert Nikotinstummel, gelb Plastemüll usw. Die Akteure schwärmen aus, befüllen die Wiese mit den Fähnchen. Dokumentieren das Ergebnis und entfernen sie wieder. Wobei sie dabei auch den markierten Müll weitestgehend entsorgen.
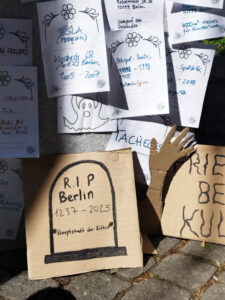
19. 05.2025 Zeughauskino, Reihe: Bezeugen und erzählen
Der Nachkriegsfilm Die Mörder sind unter uns, wurde Deutschland, der sowjetisch besetzten Zone, im zerbombten Berlin gedreht. Für Regie/Drehbuch zeigte sich Wolfgang Staudte verantwortlich.
Der Film erzählt aus der Perspektive des traumatisierten Heimkehrer Dr. Hans Mertens, der in einer Wohnung mit sichtlichen Kriegsschäden mehr recht als lebt. Mertens ist Chirurg, aber arbeitet nicht. Statt dessen sucht er täglich Lokale auf, in denen er solange verweilt, bis er betrunken ist. Eines Tages kehrt die eigentliche Mieterin, gespielt von Hildegard Knef, Susanne Wallner zurück. Statt ihn rauszuwerfen, gestattet sie ihm, zu bleiben. Was den Zuschauer verwundern darf, denn Mertens ist abweisend und schroff. Während er seiner Sauferei nachgeht, putzt, wäscht, kocht und arbeitet Wallner den ganzen Film hart durch, wenn sie nicht gerade auf sein Heimkommen wartend am Tisch eingeschlafen ist, um sich für die nächste haushalttechnische Arbeit auszuruhen.
Die Dramatik des Filmstoffes ist mit Männlichkeit ertränkt. Die Hauptdarstellerin, obwohl KZ-Überlebende, hat keine Identität als die bereits beschriebene. Auch als Hans ihr vorwirft, sie wäre wohl in Sicherheit gewesen als hier Bomben fielen, darf sie nicht wiedersprechen. Ihr Schicksal wäre nicht mit seinem zu messen. Es hätte ihn verstummen lassen. Der Film wäre hier zu Ende gewesen. Doch wir richten uns nach dem Drehbuch und da gilt es die Frage zu beantworten: Was ist Hanz Mertens Trauma? Als Wehrmachtsarzt im Gefechtsgebiet auf polnischen Boden kann er den Befehl seines Vorgesetzten Ferdinand Brückner, gespielt von Arno Paulsen, einer Tötung von 121 Zivilisten, am 24. Dezember 1942, nicht verhindern. Als er Brückner zufällig nach dem Krieg, der ist inzwischen Fabrikant und Familienvater zweier Kinder erfolgreich wie nie, bricht es aus Hans heraus. Er will Brückner zur Rechenschaft ziehen, er will ihn erschießen.
Staudte hatte bei den westlichen Alliierten um Geld für die Verfilmung seines Buches gebeten. Die lehnten ab. Die Sowjets waren dagegen offen, verlangten aber, das der Schluss geändert wird. Hans durfte den Fabrikanten nicht erschießen. Er wurde musste durch ein ordentliches Gericht verurteilt werden.
P.S. Staudte hatte Paulsen als Filmschauspieler 1945 entdeckt und ihn mit der Nebenrolle des Fabrikanten besetzt. Mir ist Paulsen lieb und teuer als Hauptdarsteller der Literaturverfilmung Der Untertan, ebenfalls in der Regie von Staudte.
Durch den Abend führte Chris Wahl, Professor für das Audiovisuelle Kulturerbe an der Filmuniversität Babelsberg KONRAD WOLF und Leiter des DFG-Langfristvorhaben „Bilder, die Folgen haben – Eine Archäologie ikonischen Filmmaterials aus der NS-Zeit“.
17.05.2025 Zeughauskino, Reihe: Bezeugen und erzählen
Zweite Filmtag der Reihe Bezeugen und erzählen (Siehe auch 16.05.2025), steht unter dem Fokus der Freude und Erleichterung der Befreiung und der Heimkehr der Deportierten und Kriegsgefangenen des NS-Regimes. Vorausgehend ist für mich interessant, dass auf Grund des Frankreichfeldzugs – der erfolgreichen Offensive vom 10. Mai bis 25. Juni 1940 gegen Frankreich – kurzfristig mehr als 1,2 Millionen französische Soldaten in deutsche Kriegsgefangenschaft gerieten. Dh., im Prinzip wurde in weiten Teilen die komplette französische Armee gefangenen genommen, was auf Seiten der Bevölkerung zu großer Enttäuschung führte. Die Lobby der Armee in ihren Augen auf Null brachte. Ebenfalls waren die Zurückgebliebenen nicht gut auf die Deportierten zu sprechen. Man sagte ihnen nach, sie hätten mit den Deutschen kollaboriert. Charles de Gaulle, Anführer des Widerstands und Präsident der Provisorischen Regierung von 1944 bis 1946 war federführend, den Status der Rückkehrer zu verbessern. Er beauftragte Filmschaffende, Heimkehrer zu porträtieren, um für Verständnis und Anteilnahme zu werben. Auch gegen die Vorurteile bei der Bevölkerung gegenüber den Deportierten wollte er etwas tun. Der Film Le Retour – Die Heimkehr, von Henri Cartier-Besson, ist einer der entstandenen Filmdokumente und er sollte sein Ziel nicht verfehlen.
Die wichtigsten Aufnahmen des Ersten der beiden heute gezeigten Filme Le Retour – Die Heimkehr, von Henri Cartier-Besson, wurde in Dessau gedreht, die letzten Aufnahmen von der Ankunft der Heimkehrer in Paris. Mit Szenen wie: bettlägerig, kranker Mann breitgrinsend rauchend oder Frau die KZ-Wärterin ohrfeigt, lachendes Baby mit Mutter, GI nimmt Baby auf den Arm und schaut dabei posierend in die Kamera, bricht die Regie das typisierte Opferbild. Hier kann der Filmhistoriker darauf verweisen, das Cartier-Bessons Regieführung eng mit der Tatsache verbunden ist, dass er selbst fast drei Jahre in deutscher Kriegsgefangenschaft geriet, Zeitzeuge ist.
Der Film wurde am 24. Januar 1946 in Paris uraufgeführt. Die Verzögerung von Produktionsende bis zur Aufführung hatte politische Gründe. Man war sich uneins, ob die Botschaft des Films auch richtig ankam.
Der Film Reunion, USA, 1946, ist eine mitproduzierte Fassung, mit neuen Kommentaren und neu hinzugefügten Bildern, ausgerichtet auf die GI und die Frage „What are we fighting for?“
Besonders eindrücklich die Szene des größten Massentransports der Luftfahrt durch die Air Force, vom 10. April bis 10. Mai 1945. Die Bilder von den fast gleichzeitig startenden Flugzeuge werde ich so schnell nicht vergessen.
Durch den Abend führte, Thomas Tode, freier Filmemacher, Kurator und Publizist.
Eine nicht synchronisierte Fassung ist einzusehen unter Link: https://youtu.be/VwY5spngkew

Von der Befreiung vom NS-Regime ohne Punkt und Komma wechsle ich am selben Ort zu: Uwe Johnson sieht fern, D 2006, Regie Saskia Walker, der Veranstaltungsreihe Der 5. Kanal – Uwe Johnson und das Fernsehen der DDR (Siehe auch 13.05.2025). Ja das war gleich im Anschluss. Ich kann nur sagen, ich habe es so nicht gemacht. Der Veranstaltungsplan lag mir so vor. Der Schriftsteller, der 1959 die DDR verließ, verfasste 1964 für den West-Berliner Tagesspiegel insgesamt 99 Fernsehkritiken – ausgerechnet über das Programm des DDR-Fernsehens. Saskia Walker hat nach Veröffentlichung „Der 5. Kanal in der Uwe Johnson-Werkausgabe“, 11 Rezensionen herausgestellt und das Filmmaterial auf das Johnson sich bezieht, dem Text hinzugefügt. Ergänzt wird der Film durch Interviews mit Johnson-Forscher:innen und Zeitgenoss:innen. Ich war ganz entzückt, dass der letzte Beitrag sich mit dem Sandmann befasste. Johnson Wortlaut: Das ostdeutsche Sandmännchen ist eine kleine Puppe mit großem hölzernem Rundkopf, daran ist ein spitzer Kinnbart, sie trägt weite Joggen, weite Umhänge, eine Mütze mit einer am Hinterkopf aufsteigenden Spitze. Das Sandmännchen kann sich bewegen. Sprechen kann es nicht. Jeden Tag … trifft es auf dem Bildschirm ein und zwar in Spielzeuggegenden und nämlich abwechselnd vermittels Auto, …Segelboot, auch zu Pferde. Das Sandmännchen wird erwartet von ähnlich großen bartlosen Puppen und muss in ihrer Menschenmäßig möblierten Wohnung den Fernsehapparat einschalten, damit ein besonderes Kinderprogramm erscheint. Allerhand Märchen, auch Geschichten von sprechenden Puppen, mit schlichten vernünftigen Lehren, oft auch bloß unterhaltend. Am Freitag Abend kam der Sandmännchen mit einer IL-18, Motoren-Propellermaschine…“ Ich bin von seiner scharfen Beobachtung, seiner kurzen, aber bildhaften Sprache zutiefst begeistert.
Den Film kann Mensch in Gänze sehen unter Link: https://saskiawalker.de/media/2024/04/saskia_walker__uwe_johnson_sieht_fern-480p-1-MP4.mp4
16.05.2025 Zeughauskino, Reihe: Bezeugen und erzählen
Das Deutsche Historische Museum beschäftigt sich in ihrer neuen Ausstellung mit der Frage: Wie verarbeiteten Nachkriegsgesellschaften die Erfahrungen von Gewalt und Vernichtung, die weite Teile Europas durch die Zwangsherrschaft des nationalsozialistischen Deutschland betroffen hat? Unter dem Titel Bezeugen und erzählen zeigt das Zeughauskino Filme, die zur Ausstellung gehören. Eröffnet wurde die Reihe mit dem Dokumentarfilm Majdanek – Cmentarzysko Europy, von Alexander Ford, der direkt nach der Befreiung des Konzentrationslagers, laut Urkundenprotokoll vom 24. und 25. Juli 1944 gedreht: Das Filmdokument gilt als das erste der Welt, das den Völkermord der Nazis dokumentiert. Der Film dokumentiert Interviews mit Gefangenen aus verschiedenen Ländern Europas, aber auch Gerichtsverhandlungen von SS-Offizieren des Vernichtungslagers Majdanek sowie Detail wie Großaufnahmen des Lagers..
Die polnische Fassung ist einzusehen unter Link: https://youtu.be/52YgNXKx5oo
Oswenim (Auschwitz) SU 1945, in der Regie Jewisaweta Swilowa dokumentiert die Befreiung von Auschwitz durch die Rote Armee. Unter anderem Enthalten in der Filmdokumente der gerichtlich medizinischen Kommission zur Feststellung und Untersuchung der Gräueltaten in Auschwitz. Zur Kommission gehörten Sachverständige für Therapie, Pathologie, Gynäkologie, Psychiatrie und Kriminalistik. Die Kommission untersuchte sie. Stellte u.a. fest, das Häftlingsnummern statt auf den Arm auf das Bein geprägt wurden, wenn diese zu klein waren. Neben Tod durch Gas, Hunger, direkte äußere Gewalt und… wurden die Häftlinge für medizinische Versuche missbraucht. So injizierte man ihnen Bspw. Flecktyphus oder -fieber. Anschließend wurden verschiedene Medikamente an ihnen erprobt im Auftrag der deutschen Pharmaindustrie. Es war gräulich anzusehen. Die Regie folgt im wesentlichen dem suchenden Auge der Kamera.
Der gezielt zur Umerziehung der Deutschen hergestellte deutsch-amerikanische Gräuel-Film Die Todesmühlen zeigt die Weimarer Bevölkerung, wie sie im Sommer 1945 das nahegelegene Konzentrationslager Buchenwald besichtigt. Fazit: Die Erziehungsmaßnahme, so spätere Einschätzungen der Filmemacher war nicht erfolgreich. Die Weimarer hätten zwar die Gräueltaten des NS Regimes nicht geleugnet, aber eine Beteiligung daran leugneten sie. Es waren ja die Anderen. Das es den Film gibt, wusste ich. Hatte ihn aber nie gesehen bisher.
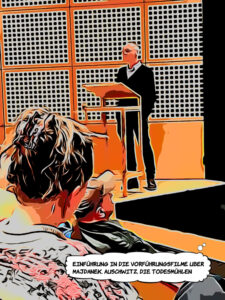
15.05.2025 Kleines Filmchen
Brigitte Bardot besuchte mich im Atelier. Wir spazierten zum Rathaus, tranken Espresso, aßen ein Eis. Aber das ist im Film nicht anwesend.
13.05.2025 Zeughauskino, Reihe: Der 5. Kanal – Uwe Johnson und das Fernsehen der DDR
Unter dem Titel Der 5. Kanal – Uwe Johnson und das Fernsehen der DDR präsentiert das Zeughauskino Berlin sechs Veranstaltungen. Den heutigen Abend begleiteten Yvonne Dudzik (Wissenschaftliche Mitarbeiterin der Arbeitsstelle „Uwe Johnson-Werkausgabe“), Dr. Andy Räder (Medienwissenschaftler) und Gast Germanist Greg Bond.
Vorgeführt wurde Prozeß Richard Waverly, DDR (1964), von Wolf-Dieter Panse. Bereits 1963 fand die Uraufführung nach dem gleichnamigen „Schauspiel“ Prozeß Richard Waverly von Rolf Schneider, im Deutschen Theater statt.
Der Film handelt vom fiktionalen Piloten Richard Waverly, der an den Folgen seiner Beteiligung am Abwurf der Atombombe in Nagasaki leidet und dessen Gesundheitszustand durch die Einlassung seines Bruders vor Gericht beurteilt wird. Figur und Hintergründe sind angelehnt an den US-amerikanischen Piloten Claude Eatherly.
Im Mittelpunkt des Verfahrens stehen die Schuldgefühle des Protagonisten und seiner daraus resultierenden Erkenntnis, eindringlich vor dem Einsatz von Atomwaffen zu warnen. Zwischen den Zeilen ist zu lesen, dass das Motiv seines Bruders, den Angeklagten Richard Waverly zu entmündigen dem Ziel dient, sich seines Vermögen zu ermächtigen, sondern auch der Diskurs um die Glaubhaftigkeit der ausführenden Befehlshaber des Atombombenabwurfs als imaginärer Gegner anwesend ist.
Dem Zuschauer wird suggeriert, dass der Abwurf nicht notwendig war, da die Japanische Armee zu dem Zeitpunkt bereits gänzlich erschöpft war. Das man aber, weil man die Bombe nun mal gebaut hatte, entgegen allen Wissens um die Gefahren, sie dennoch ausprobierte. Auch 20 Jahre nach Bombenabwurf wurden die Einsätze von der amerikanischen Regierung für legitim erklärt.
Die Atombombenopfer kommen im Film nicht vor. Einzige Ausnahme, die Aussage des Angeklagten über einen Besuch des Unglücksort im Jahre 1950. Hier wird tiefste Betroffenheit und Mitgefühl mit den Strahlenopfern deutlich, die dazu führt, dass er den Opfern aktiv hilft, auch mit der Veröffentlichung seines Prozesses.
P.S. Es müssen damals diverse Diskussionen dazu stattgefunden haben.
P.S. Die Gerichtsprotokolle der Verhandlung waren Schneider nicht bekannt.
Programmbeschreibung heißt es: „Die Aktualität des Themas, sichtbar durch die damaligen Filme im Fernsehen der DDR wie BRD, veranlasste Uwe Johnson zu einem Vergleich, wobei er am Film Prozeß Richard Waverly kritisierte, dass Autor Schneider neu veröffentlichte Erkenntnisse über Eatherly außer Acht lasse, jene wichtigen „Tatsachen“, „die seinem Stück den Anlass und den Halt nehmen.“
Johnsen hat alles, was fiktiv kategorisch war abgelehnt. Er war ein Faktenfreund. Was er wohl über die ganzen Fakenews bei TikTok & Co schreiben würde. Glaube, er würde sehr verzweifeln.
12.05.2025 Update
Die Vereinsausstellung Update 2025 ist gestern zu Ende gegangen. Ich hole meine Arbeit ab.
11.05.2025 Offenen Ateliers Reinickendorf
Die unter meiner Mitwirkung an diesem Wochenende uraufgeführte Performance Eirene, von Rosika Janko-Glage wird filmisch von Andrea N. festgehalten und im Anschluss auch zusammengeschnitten.
Wie man im Video sehen wird, sind Passanten stehen geblieben, haben der Performance – bei der ich den Gong schlage (eine bescheidene, aber elementare Tätigkeit für die Darbietung) – beigewohnt und sich zudem an dem partizipatorischen Teil der Aufführung beteiligt. Nach einer der Aufführungen habe ich einen 4-5 Jahre alten Jungen ermutigt, den Gong zu schlagen. Erst zögerte er, dann schlug er ihn mehrere Male, mit jedem Mal etwas mutiger. Ein noch jüngerer Junge mit Papierkrone und goldenen Papierumhang stürzte auf ihn zu und fragte: Was ist hier los? Der Junge antwortete: Hier hat gerade jemand über den Frieden geredet.
Am Abend fahre zur Preisverleihung des En Plein Air Malwettbewerbs, der Galerie creative game. Treffe wieder auf Andreas Mattern und Alex Streit. Der Publikums- und Jurypreis geht nicht an mich.

10.05.2025 Galerie F 37
Auf Angebotsanfrage der Frau Barbara Petermann suchte ich heute die Galerie F 37 in der Fasanenstraße auf.
Beim Eintreffen stand die Tür weit offen. Die Herrin über die Räume Frau Petermann saß im linken, der beiden Ausstellungsräume hinter einem schweren Schreibtisch auf einem Stuhl. Sie bleibt trotz meines Eintretens sitzen. Ich: Sie sind Frau Petermann, ich bin Frau… Sie: Hängen Sie ihre Garderobe im Raum hinter mir an. Ich: Komme ihrer Aufforderung nach. Gehe zurück zu ihr vor ihren Schreibtisch. Sie: Wie kommen Sie auf die Galerie? Ich: Durch Ihre Angebotsanfrage. Sie: Nulllinie. Pause. Sie: Steht auf, führt mich durch die Galerie. Setzt sich an ihren Schreibtisch. Ich: Ich suche mit den Augen den Raum ab. Lokalisiere einen Stuhl, durchsichtig aus Kunststoff, positioniere ihn so, dass er für eine Gesprächssituation Sinn ergibt. Sie: Die Galerie war ehemals die Galerie Bremer. Ich: Ist mir bekannt. Sie: Wir nehmen 40 – 50 % Provision. Ich: Davon konnte ich ausgehen. Sie: Wir machen Einzelausstellungen und zwei Gruppenausstellungen im Jahr. Ich: Ja. Sie: Wir nehmen eine Vorprovision. Ich: Eine was? Sie: 1000,- €. Während der Berliner Art Week 10.000,- €. Auch während des Gallery Weekend Berlin mehr. Man kann auch bei Gruppenshows für 500,- € mitmachen. Die nächste Gruppenausstellung ist im Juni, am 6. ist Vernissage. Die Einladungen sollten schon dafür vorliegen…. Ich lade Sie dazu ein. Abgang.
Zwei Stunden später befinde ich mich auf dem Künstlerhof Frohnau, wo ich in ein Gespräch mit einer Gästegruppe der Offenen Ateliers Reinickendorf – dem Atelier von Rosika Jankò-Glage – über den Müther-Turm und seinen Architekten Ulrich Müther verwickelt bin. Sie führen auf, welche Reiseregionen an der Ostsee ihnen bekannt sind und welche Bauten von Ulrich Müther ihnen außer dem Mühter-Turm noch bekannt sind. Am Ende können Sie gar nicht anders als aus meinem Kaufangebot dazu etwas mitzunehmen.
9.05.2025 Vernissage En Plein Air
Reden, Musikeinlage der Galerie Creative Game, anschließend Wasser und Wein im Vorgarten. Zu meiner Überraschung wird mir ein Namensvetter namens Alex Streit vorgestellt. Wir stellen schnell fest, dass keine verwandtschaftlichen Verhältnisse vorliegen.
Mein Wettbewerbsbeitrag hängt so, dass er bei geöffneter Tür weitestgehend verdeckt wird. Die Tür ist am Abend der Vernissage weit geöffnet. Gespräche mit den Veranstaltern darüber führen nicht dazu, das meine Farbzeichnung umgehängt wird, noch würde. Ich gehe daher mit einem Gefühl der … von dannen. Davon unberührt bleibt die Zeichnung selbst. – Sie ist was sie ist, eine Zeichnung.

8.05.2025 Atelierhof Frohnau, Stellprobe
Den halben Tag verbringe ich auf dem Atelierhof Frohnau, bei Rosika Janko-Glage. Wir essen Kürbissuppe zur Stärkung ehe wir mit der Stellprobe, ihrer Installation Eirene – vor ihren Atelierräumen – beginnen. Rosika ist noch unsicher. Da sie ihr Werk und die damit verbundene Performance im Programmheft des Veranstalters der Offenen Ateliers Reineckendorf veröffentlicht wurde, muss sie sich dem stellen.

7.07.2025 Atelier
Arbeite an den zwei großen Bildern, siehe Foto und an einem Kleinformat weiter. Höre nebenbei ein Hörbuch über einen amerikanischen Elitesoldaten mit psychischen Einschränkungen. Der Soldat wird als Vorhut in Krisengebieten eingesetzt, wo er seinen psychischen Einschränkungen gemäß, Menschen bestialisch foltert und tötet. Wenn er nicht in Kriegsgebieten eingesetzt ist, arbeitet er in Gebieten mit Gesellschaften wie Berlin und so weiter.

5.05.2025 Lesung Christoph Hein
Gemeinsam mit Brigitte Bardot haben ich an der Lesung Das Narrenschiff von Christoph Hein, im Haus des Rundfunks teilgenommen.
Nachzuhören unter: https://www.ardaudiothek.de/episode/radioeins-events/das-narrenschiff-die-schoene-lesung-mit-christoph-hein/radioeins/14523307/

4.05.2025 Comicinvasion und Abgabe Kunstwerk
Mit Charlotte die Comicinvasion besucht, die im Lichthof des Museums für Kommunikation präsentiert wird.
Von dem Comickünstler mic erwarb ich Papa Dictator Weltherrschaft. Die Schlüsselworte Dictator und Weltherrschaft hatten bei mir sofort ausgelöst, dass ich mich amüsiert fühlte. Ich dachte dabei auch an den größten und besten Präsidenten der Welt, Donald Trump. mic erzählte mir, dass er 2013 die Figur Papa Dictator zum leben erweckte. Saddam Hussein hatte ihn dazu inspiriert. Auch über Donald Trump ist ein Comic zu seiner 1. Präsidentschaft entstanden. Nun soll es eine Fortsetzung geben. Wie er heute erfuhr von seiner Verlegerin, hat sie bereits Lizenzen dafür verkauft. Es sagt sinngemäß: Das setzt mich unter Druck. – Denn es ist nicht einfach, die Realität zu überhöhen, die bereits so überhöht ist. Ja der Orange Mann macht es der Comic- und Satirebranche sehr, sehr schwer. Das habe ich durch mein Interesse für Trump und der Überlegung, ob Kollectiv: Thinking of Yves eine Fortsetzung ihres Präsidentenporträts, aus Anlass Donald Trumps Wiederwahl machen sollen , schon für mich erkannt.
Ich bekomme für den Erwerb des Buches über die Weltherrschaft eine Widmung samt Zeichnung inclusive.

Charlotte entscheidet sich für das Comic Verlagswesen, von Annette Kühn, der Verlegerin des Jaja Verlags. Kühn hat ihre eigenes Berufsleben darin wiedergespiegelt und liebenswerte Figuren zum Leben erweckt. Gute Kaufentscheidung.
Charlotte und ich vereinbarten ein gemeinsames Comicprojekt ins Leben zu rufen. Aufgabe, ein Panel zeichnen, dann zeichnet das nächste Panel die andere und so weiter. Wir eine Frist von einer Woche fest für die Aufgabe Bearbeitung und Weitergabe. Früher, schneller geht natürlich auch.
Gerade noch rechtzeitig gebe ich vor 18 h in der Galerie creative game mein Kunstwerk für das En Plein Air 2025 ab, das am 9. Mai 2025 in einer Gemeinschaftsausstellung der Öffentlichkeit vorgestellt wird.

3.05.2025 Lilienthal Villen
Brigitte Bardot in Berlin-Lichterfelde, arbeiten heute zeichnen heute in der Paulinenstraße, Berlin-Lichterfelde. Wir sitzen auf unseren Tritthockern. Ich verfolge den Plan, eine Art Panoramabild herzustellen. Mindestens drei Karten soll das Motiv aneinander gereiht ausfüllen. Ehe wir beginnen konnten, musste ich mir in der Galerie creative game Stempel auf die Rückseite meiner Zeichenkartons auftragen lassen, zu dem der Veranstalter des En Plein Air 2025 die Teilnehmer verpflichtete.
Die Lilienthal Villen waren mir bis zu diesem Pleinair unbekannt gewesen. Anrainern nach, mit denen ich heute sprach, sind alle Villen bewohnt. Sie stehen alle unter Denkmalschutz. Man möge, was man täglich vor der Nase hatte. Als man selbst noch nicht hier im Villenviertel lebte, konnte man sich gar nicht vorstellen, wie es sich hier lebt. Aber seit man selbst hier angekommen ist, kann man sich nichts Schöneres mehr vorstellen.
Ich könnte es mir vorstellen, aber ich weiß nicht wie es dazu kommen kann. Heirat? Sponsoring?…

1.05. 2025 Botanische Garten
Mein erster Besuch im Botanischen Garten, Berlin-Lichterfelde, in Begleitung mit Brigitte Bardot. Wir zahlen unseren Sold und betreten das Gelände mit der artenreichen Pflanzensammlung., der im 1899 angelegt wurde. Ich benutze gleich mal die Toiletteneunrichtung. Dann laufen wir auf dem Gelände herum, lassen uns auf einer Bank nieder. Machen Skizzen. Gehen ins Cafe. Es gibt Kaffee und Kuchen. Wir setzen uns an einen Tisch mit zwei jungen Menschen aus Griechenland. Sie leben seit einem Jahr in Berlin. Brigitte: Greec is hot, verry hot, und schon beginnt eine kleine Plauderei zwischen uns. Hitze, ja, die großen und kleinen Flächenbrände unnützlich usw. Ich suche ein zweites Mal die Toiletteneinrichtung auf. Trinke den Kaffee, esse den Apfelkuchen auf. Trete mit Brigitte ab. An einen der zwei kleinen Seen schlagen wir am Ufer unser „Lager“ und zeichnen. 18 Uhr brechen wir auf, laufen zum Ausgang. Ich suche die Toilettenrichtung auf. Abreise mit Auto in die Innenstadt.

28.04.2025 Atelier

27.04.2025 Lese „Der geschenkte Gaul“
Die Autobiografie ist Bombe.
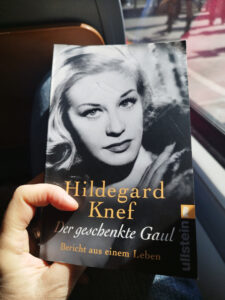
23.04.2025 Atelierhof Frohnau und Architekturvortrag in der Max-Lingner-Stiftung
Den halben Tag bei Rosika Janko-Glage auf dem Atelierhof Frohnau verbracht. In meinem mitgeführten Gepäck ein paar Gemälde, eine Kiste mit 216 Pleinairzeichnungen, ein Karton mit Original-Druckgrafiken und Prints. Einige der Mitbringsel wurden im Wohnatelier platziert für das anstehende Atelierwochenende Reinickendorf, vom 10. bis 11. Mai 2025, zu dem mich Rosika in ihr Atelier eingeladen hat.
Rückblick: Bei meinem Besuch am 9.03.2025 hatten wir bereits Erweiterungspläne für ihre Installation Eirene, die im Freien präsentiert werden würde, geschmiedet. Ich darf dafür in eine aktive Rolle schlüpfen und einen Gong schlagen. Ich liebe Gong schlagen sehr und habe bei meinem heutigen Besuch den Gong auch mehrmals geschlagen. Rosika wollte mir den Gong sogar mit nach Hause zum „üben“ mitgeben, aber ich widerstand der Versuchung. Ich bat sie noch bis zum nächsten Besuch über ihre Installation einen Text zu schreiben. Sie kam der Bitte nach und las mir nun heute den Text laut vor. Ich war beeindruckt. Schlug ihr spontan vor, ihn einzusprechen und der Installation hinzuzufügen. Das gefiel ihr. Kurz darauf machten wir unsere Aufnahmen für das Audio. Die Zeit verging wieder wie im Fluge. Ehe ich den Atelierhof verließ machten wir noch eine Stellprobe von Installation für das Atelierwochenende Reinickendorf.

19 Uhr traf ich anschließend beim Architekturvortrag: Max braucht Gesellschaft. Der Kulturpalast Unterwellenborn, der Max-Lingner-Stiftung mit Refent Christoph Liepach ein. Obwohl ich aus Thüringen stamme und in der DDR aufwuchs, ist mir der Palast wie der Ort Unterwellenborn unbekannt. Der Palast Unterwellenborn ist mit rd. 6000 qm2. Nutzfläche der größte aller etwa 2000 Kulturpaläste bzw. Kulturhäuser in der DDR gewesen. Der Palast wurde für die stark anwachsende Stahlindustrie Max Hütte erbaut und 1956 eröffnet und mit Leben gefüllt. Neben Konzerten für bis zu 720 Personen, fanden dort auch Tanzveranstaltungen statt. Zudem hatten X viele Arbeitszirkel darin ein Zuhause. Die Arbeiter sollten den Vorstellungen der SED gemäß gebildet werden.
Der Vortrag befasste sich vornehmlich mit der Vorstellung des gleichnamigen Buches und seiner Mitwirkenden. Christoph Liepach berichtete von der glanzvollen Vergangenheit und stellte Bildmaterial vor. Außerdem kam der thüringische Architekt Thomas Zill zu Wort, einer der 17 Gründungsmitglieder des Verein Kulturpalast Unterwellenborn e.V. (https://www.kulturpalast-unterwellenborn.de/index.php/verein), der 2013 gegründet wurde. Zill berichtete von den Gesprächsversuchen mit dem Eigentümer Knut Schneider, Immo-Möbel GmbH & Co. KG aus Kronach, um dem Kulturgebäude, das seit 1987 unter Denkmalschutz steht, einem neuen Nutzungskonzept zu überstellen. Der Eigentümer hatte 1994 das Gebäude samt Grundbesitz für 180.000 DM erworben vom Land Thüringen. Zill erzählte, das Schneider eine Immobilien-Verkaufsanzeige geschaltet hatte, die besagt, dass er den „Palast“ für 10 Mill. Euro anbietet. Man wolle nicht den harten Weg der „Enteignung“ gehen, weil man u.a. gesteuerten Vandalismus befürchtete. Seit 2019 hat der Eigentümer den Zugang für Außenstehende zum Palast untersagt. Es fand mit verlesener Hand ein Treffen mit dem Eigentümer und seiner Tochter statt. Die Tochter sei Architektin und habe durchaus die Bedeutung des Gebäudes erkannt. Ob sie Einfluss auf ihren Vater nehmen kann, damit es zu einer Einigung kommt, ließe sich nicht sagen. Man hoffe, wisse aber nix. Der Verein wird Ende des Jahres seine Tätigkeit beenden, wenn ich es richtig verstanden habe.
Link zum Vortrag: https://youtube.com/live/o2quwl6qS10?feature=share
20.04.2025 Wettlauf um Berlin
Den Ostersonntag nutze ich gemeinsam mit Brigitte Bardot für eine Fahrt in den Oderbruch, mit Abstecher zur Gedenkstätte Seelower Höhen. Vom 16. bis 20. April 1945 tobte dort der größte Stellungskrieg auf deutschem Boden zwischen der 9. Armee der Wehrmacht und der Roten Armee, unter dem Kommando von Marschall Georgi Schukow. Der Kampf war, weil es der deutschen Wehrmacht an Soldaten und Ausrüstung fehlte, bereits vor Beginn der großem Schlacht verloren. Allerdings erhoffte sich die deutsche Wehrmacht dadurch, den Armeen der Westfront durch den Kampf an der Ostfront etwas mehr Zeit verschaffen zu können, damit diese vor der Roten Armee die Reichshauptstadt Berlin erreichten. Das wäre nicht nur ein „faktischer Sieg vor den Anderen“ gewesen, sondern und das gewichtiger, ein ideologischer Sieg.
Die Gedenkstätte selbst besteht aus dem Ehrenmal eines jungen Sowjetsoldaten, der sich über 200 Grabstellen gefallener Rotarmisten erhebt. Auch zwei Dokumentationsgebäude finden sich am Hang des Hügels.
Auf einem gepflasterten Plateau steht von Witterungsbedingungen gezeichnetes sowjetisches Kriegsgerät: neben Panzer, Raketenwerfern und Geschützen auch einer der Flak-Scheinwerfer. Die Kriegsgeräte sind durch Absperrungen mit Ketten vor „Begehungen“ geschützt.
Besonders in Erinnerung ist mir der Dokumentationsfilm Das letzte Schlachtfeld Europas (2021, 36 min) geblieben, der auch Originalaufnahmen der Schlacht zeigt. U.a. am Boden liegende, scheinbar leblose Soldaten wurden von Kriegsfahrzeugen überrollt und in den morastigen Boden der Oderwiesen eingedrückt.
*Bei meiner Recherche festgestellt: Verschiedene Quelle, veröffentlichen verschiedene Statistiken über Anzahl der Soldaten und Rüstungsmaterial der Schlacht auf den Seelower Höhen.

Weitere Stationen am Ostersonntag waren das Gasthaus zur Ostbahn in Trebnitz, wo wir Karl Heinz trafen. Das Cafe betreibt seit zwei Jahren Barbaras Küche, welche seit 10 Jahren in Berlin etabliert ist. Ich hatte ein Linsencurry mit einem riesigen Pils drauf, dessen Namen ich mir nicht merkte. Jedenfalls war das ein leckeres, modern interpretierte Speise. Den Kaffee nahmen wir dann bei Karl-Heinz Zuhause ein, der ein mehr als 100 Jahre altes Haus bewohnt, mit einem traumhaft schönen Gartengrundstück.

18.04.2025 Zeughauskino
Meinem Drang nachgehend nach deutscher Geschichte haben Brigitte Bardot und ich an der Vorführung unter dem Titel: Berlin. Dokument/ Berlin in den Achtziger Jahren (30) – Material West-Berlin V: Nachdenkliches über die Halbstadt im Zeughauskino teilgenommen.
Die vier gezeigten Kurzfilme: Faces (BRD 1988), Dem (BRD 1989), beide in der Regie von Antje Stroast und Hans-Helmut-Grotjahn sowie Böse zu sein ist auch ein Beweis von Gefühl (BRD 1983) und Cycling the Frame (BRD 1988), in der Regie von Cynthia Beatt, fielen bei uns in der Gesamtwertung durch.
17.4.2025 Atelier
Möchte für das Format meiner Pleinairarbeiten gern vergrößern. Die bisher angewandte Technik der Stiftzeichnung sehe ich dafür aös ungeeignet an. Legte eine Landschaft zu Studienzwecken daher mit Vinyl und Acrylfarben auf einem Mittelgroßen Papierbogen an. Fazit: Grr, noch unbefriedigend. Arcyl kann ich nicht, liegt mir nicht.
12.04.2024 Peinair-Saison eröffnet
Die Pleinair-Saison ist eröffnet, verkündet Valentyna Ivanova freudvoll. Im Winter beschäftige sich mit Camouflage, von Frühjahr bis Herbst mit Pleinairmalen, was ihre wahre Leidenschaft ist!
Ich bin ganzjährig draußen zum zeichnen.
P.S. Im Bild unten: Ich, Olga Ivanova, Brigitte Bardot, Helen, Valentyna Ivanova.
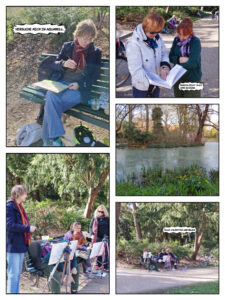
11.04.2025 Vernissage im Verein
Mit 40 Minuten bewusster Verspätung bei der Eröffnung der Vereinsausstellung Update 2025 eingetroffen. Da der offizielle Teil bereits vor meinem Eintreffen beendet war, konnte ich mich gleich dem geselligen Teil – quatschen – widmen. Mit Rosika Janko-Glage sprach ich über ihr Auto und die Ausstellungsregeln des Vereins, mit Michael Augustinski und Burghild Eichheim über Projektbewerbungen, mit Sylvia Seelmann über die Fortschritte ihrer Genesung nach ihrem Unfall, mit Nele Probst und Helga Wagner über die Stimmung in der AAG (Ausstellungsarbeitsgruppe des VBK, der ich selbst von 2010 bis etwa 2017 angehörte) und Vasyl Nevmytiy über die Berliner Philharmonie und die Ukraine. Mit Susanne Knaack über ihre Haare, die wie ich meinte, nicht nur länger, sondern auch in einer viel größeren Anzahl auf ihrem Haupt wuchsen. Susanne lachte. Meine Erinnerung an ihr Haupt würde mich trügen.


Es fanden noch weitere, aber kurzweilige Plaudereien statt, bis hin zur Ankunft von Valentyna Ivanova, ihrer Mutter Olga, ihrer Tochter Ewa, ihres Sohns Kuzma, ihrer Nichte und ihrer Freundin Helen. Wir ließen uns für die Social-Media Plattformen ablichten und verabredeten und für ein kleines Pleinair im Englischen Garten.
9.04.2025 Party
War mit Brigitte Bardot bei der Vernissage in den Skandinavischen Botschaften der Ausstellung Camouflage-Tarnung als Schutz und Ausdruck von Identität, von Valentyna Ivanova, Künstlerin, und Schülern der Deutsch-Skandinavischen Gemeinschaftsschule Berlin. Anschließend besuchten wir mit anderen Gästen der Vernissage Andjey Pozdin (Musiker) und Yulia Samofalova in ihrem Zuhause, nahe dem KaDeWe. Dort nahmen wir Platz an einem großen Tisch. Aßen Oliven, Pizza, Bürger, Tomaten, vegane Brotschnittchen, tranken Tee, dann Wein dazu und hörten zum Abschluss im Salon Andjey und Yulia beim musizieren zu.
Toller Abend. Danke.

8.04.2025 Kino
War mit Charlotte im Kinofilm Mit der Faust in die Welt schlagen, der Regisseurin Constanze Klaue. In den Beschreibungen zum Film, die zu lesen sind, heißt es irrtümlich, es handle sich um einen Film über Rechtsradikalismus im Osten...Beschwörungsformeln wie: die volle Wahrheit über… was bisher verschwiegen wurde…Gut, drei rechts gesinnte Jugendliche kommen darin vor, dennoch, es ist kein Film über Rechtsradikalismus im Osten! – Nicht mal über Rechtsradikalismus.
Es ist ein Film über eine Familie, in einer strukturschwachen Region Deutschlands, die den Zenit des wirtschaftlichen Niedergangs längst überschritten hat. Die Zeit „Der heilen Welt“, in der der Traum vom Eigenheim eine reale Gestalt annahm, ist nun, nicht abrupt – man hätte es vorhersehen können – zu einem lästigen Umstand geworden. – Auch, weil der Häusle`bau vom arbeitslosen Vater Stefan (Darsteller Christian Näthe) durchgeführt wird, der von Filmbeginn an, inzwischen fünf Jahre andauernder Bauzeit als Elektrik- und Sanitärinstallation-Hilfsmonteur und ebenso als Automechaniker erfolgsarm charakterisiert wird. Die Mutter Sabine (Darstellerin Anja Schneider) hilft von Grund auf nicht mit beim Haus fertigstellen. Warum, wird nicht erzählt. Sie stellt Anforderungen an den Mann, das und das soll repariert werden. Er soll Zuhause bleiben, nicht immer zur Nachbarin gehen. Sie geht trotz das er fort ist und auch wenn er da ist, ihrem Beruf als Krankenschwester nach und obwohl sie mehr arbeitet als sie muss, macht sie Essen für alle, sogar warmes. Und sie hält außerdem den Kontakt zu ihren zunehmend kränkelnden Eltern.
Es könnte alles leichter, besser sein, wenn Stefan Erfolg hätte. Wenn er reparieren könnte, wenn er einem Beruf nachgehen täte, Geld nach Hause brächte. Wenn Sabine nicht Doppelschichten schieben müsste, nicht immer so pessimistisch und gereizt rüber käme. Wenn sie miteinander reden würden. Wenn er trotz seiner fraglichen Daseinsberechtigung als Familienoberhaupt, wie es sich darstellt nun mal, Anerkennung, Fürsorge, Anreize intellektueller und körperlicher Art erhielte. Dann, dann wären die beiden Söhne Tobi und Philipp nicht isoliert von sich und der „Welt“. So aber, in dieser sehr wohl toxischen Umgebung, die vor Einsamkeit nur so strotzt, müssen sie Dummheiten machen. Müssen sie größeren und stärkeren und ja auch exotisch wirkenden Halbmännern sich anschließen. Sie haben Angst vor denen, aber egal, es ist wenigstens ein Gefühl, wenigsten jetzt in ihnen.
Charlotte hat es für mich gut zusammen gefasst: Es ist ein Film über Einsamkeit.
Nachtrag, der Film ist nach dem gleichnamigen Roman von Lukas Rietzsche entstanden. Er folgt nicht immer seiner Vorlage. So brennen hierin beide Brüder die Schule ab. Im Film hat sich Philipp nicht daran beteiligt.
Der Film ist unbedingt sehenswert, aber unter einem anderem „Stern zu sehen“, darauf bestehe ich. Besonderes der Darsteller des kindlichen Tobias Camille Loup Moltzen hat hervorgestochen. „Ein sprechendes Gesicht“, sagte Charlotte. Ja, ja, ja. Von dem wird die Welt noch viel sehen.
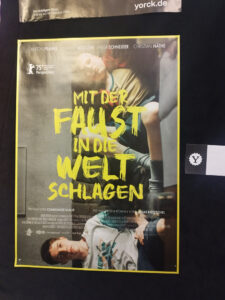
5.04.2025 Kino Dokumentation
Mit Brigitte Bardot kurzfristig die biografische Filmdokumentation Ich will alles. Hildegard Knef, Regie Lucia Schmid, im Kino Am Friedrichshain gesehen. Der Film arbeitet mit Archivmaterial, Interviews mit Knefs Tochter Christina Palastanga und ihrem letzten Ehemann Paul von Schell, mit Behind-the-Scenes-Aufnahmen und mehr. Knef als Chansonette war mir bekannt. Knef als Schauspielerin und Autorin dagegen nicht.
Den Film ist sehenswert für alle, die sich für die Generation des 2.Weltkrieges und deren Leben danach interessieren wie die, die Chanson mögen. Das Hildegard Knef eine überaus bemerkenswerte Autorin war, kommt noch hinzu.
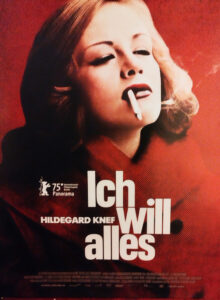
3.04.2025 Heimathafen Neukölln
Brigitte Bardot besuchten das Theaterstück Heimweh wonach, Heimathafen Neukölln, Buch und Regie von Wera Herzbergeine. In dem Zwei- Personenstück erzählt das Stück von ihre eigenen jüdischen Familiengeschichte. Aus der Perspektive der 1948 geborenen Tochter, wird der Lebensweg ihrer 1921 geborenen Mutter erzählt. Sie ist 17 Jahre alt als sie mit einem Jugendtransport nach England zu ihrem Onkel fährt und somit den Vernichtungsabsichten des herrschenden NS-Regimes entkommt. Die in Berlin zurück gebliebene Mutter wurde 1943 in Auschwitz ermordet.
Sie arbeitet und lernt die Sprache während sie Waffen für die englische Armee in einer Fabrik herstellt. Eines Tages lernt sie einen jungen Mann kennen, er ist Kommunist. Noch in England lebend wird sie Mitglied der dort erstmals gegründeten Freien Deutschen Jugend (FDJ) und der illegalen Kommunistischen Partei Deutschland (KPD). Nach dem Krieg geht mit ihm zurück nach Deutschland. Zuerst leben sie in der Westzone, dann lässt sich das Paar in Ostberlin nieder. Sie wird Staatsanwältin, bekommt 1948 eine Tochter. Das Paar bezieht ein Eigenheim. Beide sind Workaholics und stark mit den ideologischen Werten der Deutschen Demokratischen Republik (DDR) verbunden. Die viele Arbeit, das wenige Familienleben… er geht fremd. Das Paar trennt sich, lässt sich scheiden. Sie sucht Hilfe bei der SED für ihre private Situation, möchte weniger arbeiten. Aber die Partei sagt NEIN…Das und mehr wird im Stück erzählt. Das Theaterstück gefällt mir nicht wie und welche Mittel dafür eingesetzt werden.. Ich erwische mich, gelangweilt.

29.03.2025 Maxim Gorki Theater
Mit Brigitte Bardot die Aufführung Planet B, von Yael Ronen, im Maxim Gorki Theater besucht. Es ist eine Dystopie über das „plötzliche“ Aussterben der Erde im 21. Jahrhundert.
Für das Aussterben hat der Mensch auf der Erde selbst gesorgt, aber den „Laden“ ausknipsen werden laut Theaterstück Aliens. Im Traum sprechen sie zu allen Arten. Sie sind allen weit überlegen. Keiner kann etwas dagegen tun. Zu Forschungszwecken sollen 5% der Lebewesen jedoch auf einen anderen Planeten stationiert werden. Um herauszufinden welche der Arten die größten evolutionären Schritte, welche noch weiteres Entwicklungspotential haben, veranstalten sie eine Reality Show, in der die Arten gegeneinander antreten sollen. Sie können selbst einen Jemanden vorschlagen, aber die meisten Arten scheitern daran einen Vertreter vorzuschlagen. In dem Fall wählen die Aliens die Teilnehmer per Zufallsgenerator aus. Für die Menschen fällt das Los auf Boris, einen Versicherungsvertreter. Er tritt gegen Huhn, Panda, Ameise, Fuchs, Fledermaus und Krokodil an. Tatsächlich habe ich selten so gelacht. Es war ideen- und variantenreich. Die Tiere haben Charakter und Persönlichkeit, ja sogar Abgründe. Da ist zum Beispiel der lebensmüde, depressive Panda oder das Huhn, das sich als Eier-Industrie-Überlebende positioniert. Hier hat sich die Wiederwärtigkeit des Menschen besonders gut drin gespiegelt. Allerdings ist das Huhn selbst von den Aliens nicht zu den Arten erwählt wurden, die das aktive Massenaussterben durch die Aliens überlebten. Warum nicht, verrate ich nicht.
Fazit: Toller Theaterabend.

20.03.2025 Atelier

13.03.2025 KOMISCHE OPER
Der Generalprobe Echnaton, in der Regie von Berry Kosty in der Komischen Oper beigewohnt. Die Oper ist leider bei mir komplett durchgefallen. Dabei bin ich ein großer Fan des Komponisten Philp Glass.
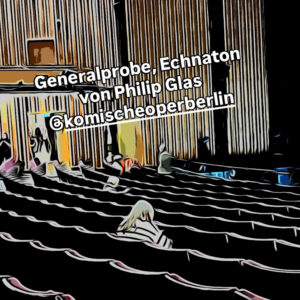
12.03.2025 Comic Workshop im Dokumentationszentrum für Zwangsarbeit im Nationalsozialismus
Nehme als eine von 12 Teilnehmern an dem 3tägigen Workshop Gemeinsam Geschichte zeichnen! Endstation Karya? Zwangsarbeit und Holocaust in Griechenland teil. Der Kurs wird veranstaltet vom DZ für Zwangsarbeit im Nationalsozialismus, unter Leitung von Elke Renate Steinert, bei der ich im Herbst 2024 bereits einen VHS-Kurs belegt hatte.
Nach einer Führung durch die Gedenkstätte und ersten Comic-Zeichen-Übungen ist der Tag wie im Fluge vergangen. Ich bin happy.

10.03.2025 Atelier
Dem neuen Bild hat heute einen neuen Hintergrundton erhalten.

9.03.2025 Besuch im Atelier von Rosika Jankó-Glage
Besuche Rosika Jankó-Glage in ihrer Atelierwohnung auf dem Atelierhof Frohnau, auf dem sie über 20 Jahre lang lebt und arbeitet. Der Hof ist sehr schön gelegen, mitten in einem Waldgrundstück. Ich bin gern dort. Jedes mal, wenn ich mich auf den Weg dahin mache, denke ich, dass das meiner Gesundheit zugute kommt. Bessere Luft und so.
Rosika bewirtete mich mit einer warmen Mahlzeit, die bei einem Spaziergang um den Hubertussee im Verdauungstrakt mäßig bewegt wurde. Rosika erzählte mir, dass der Hubertussee verpachtet ist und der Pächter es überhaupt nicht gern sieht, wenn sich Passanten am Seeufer aufhalten. Am liebsten würde er eine große Mauer mit Sichtschutz errichten, so die Vermutung der Anlieger. Allerdings erkennen die Anlieger an, dass der Pächter gut für den See sorgt. Jährlich baggert er den Grund aus, was die Wasserqualität verbesserte.

6.03.2025 Atelier

2.03.2025 Künstlergespräch „Leib und Seele“
In der Galerie VBK fand das Künstlergespräch der Ausstellung „Leib und Seele“ statt, an dem ich teilnahm. Nach dem offiziellen Teil sprach ich mit Anna von Bassen und Corinna Rosteck über ihre Ausstellungspräsentationen. Bezugnehmend auf Anna‘ s Porträts von Stars, erfuhr ich, dass sie auch Fotoporträts von Nicht-Stars gemacht habe, um ihren Stars ein Gegenüber zu stellen. Sie kam aber zu dem Schluss, dass die Nicht-Stars weniger interessant auf sie wirkten. Sie nimmt an, das es am Star-Styling, am Star-Makeover.. liegt. Corinna fragte ich, warum sie darauf besteht, Malerin zu sein, obwohl sie Fotos macht und ausstellt? Sie zitiert als Antwort Man Ray: Ich male was ich nicht fotografieren kann und ich male, was ich nicht fotografieren möchte.

28.02.2025 Kinofilm „Konklave“
Habe mit Brigitte Bardot den Film Konklave im Kino Kulturbrauerei gesehen. Regie führte Edward Berger. Leider zunehmend langatmig. Erzählt nichts, was ich nicht schon im Film Illuminati erfahren konnte.
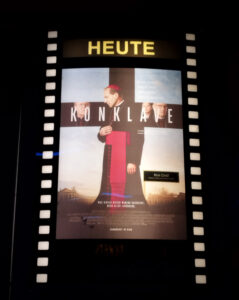
21.02.2025 Berliner Philharmonie
Die US-amerikanische Dirigentin Marin Alsop dirigiert Naturbilder unter dem Titel Paradise lost. Ich war anwesend und glücklich. Besonders gefiel mir die Komposition Fire Music für Orchester (Deutsche Erstaufführung) von Brett Dean, wegen ihrer Bandbreite an Musikinstrumenten von Streich, Blas-, Blech- und Schlaginstrumenten, wie der Einsatz von Elektroniksounds.

12.02.2025 Atelier

11.02.2025 Zweite Mal Kinofilm „Maria“
War mit der Künstlerin Rosika Janko-Glage noch einmal im Kinofilm Maria. Rosika hat Zweifel an der Seriosität der Filmgeschichte geäußert, da u.a. die Darstellung der Callas durch Angelina Jolie dem Original nicht nahe kam. Jolie sei viel zu schön, kritisierte Rosika. Callas sei vor ihrem Tod abgemagert, tablettensüchtig und depressiv gewesen. Das habe man der Filmfigur nicht angesehen.
Also … Ich habe ein Interview mit dem Regisseur inzwischen gesehen, in dem er davon berichtete, dass man nicht wisse, wie die „letzten Tage der Callas“ wirklich aussahen. Die Callas habe sich nach lange vor ihrem Tod von der Öffentlichkeit zurück gezogen. 50% der Filmstory wären belegbaren Ereignissen nachgestellt. 25% gingen auf Ereignisse zurück, für die es nur bedingt Belege gibt und 25% wären reine Dichtung. Also wenn der Film zu …% Anteilen Erfindung ist, dann kann das alles auch so gewesen sein.
Angelina Jolie soll keine aufgespritzten Lippen haben, laut meiner Google-Recherche. Die Lippen hatten mich tatsächlich auch irritiert. (Siehe auch Artikel vom 6.02.2025)
10.02.2025 Atelier.
.
6.02.2025 Maria
Der chilenische Regisseur Pablo Larraín Matte hat mit der Filmbiografie Maria, der Sopranistin Maria Callas ein Denkmal gesetzt. Ich war beseelt, ich fühlte mich ergriffen, von den Einspielungen. einiger ihrer großen und berühmten Ariendarbietungen. Die, die Callas darstellende Schauspielerin Angelina Jolie kannte ich bis dato nicht bzw. ist mir bisher nicht im Gedächtnis geblieben.
Danke, Danke, Danke.
Unbedingt ansehen!

4.02.2025 Orgelkonzert mit KMD Andreas Fischer
Erstmals besuchte ich den Französischen Dom am Gendarmenmarkt, aus Anlass eines Orgelkonzerts des Kirchenmusikdirektors Andreas Fischer. Vorgetragen wurden Werke von Johann Sebastian Bach und François Couperin.
Der Französische Dom, ein Kuppelbau, der an die Friedrichstadtkirche angebaut wurde, ist innen wie außen schön anzusehen, was abgesehen von formalen Merkmalen auch mit der hellen Farbgebung der Innenräume wie Außenfassade zu tun haben dürfte. Also fein, sehenswert. Muss ich auch mal zeichnen demnächst..

2.02.2025 Aufstand der Anständigen – Demo für die Brandmauer
Ein CDU/CSU-Antrag zur Migrationspolitik hatte am 30.01.2025 mit den Stimmen der AfD-Fraktion eine Mehrheit im Bundestag bekommen. Infolge dieses Ereignisses kam es zu bundesweiten Protestdemonstration. Ich beteiligte mich an der Demonstration Aufstand der Anständigen – Demo für die Brandmauer. Sie startete auf der Wiese vor dem Bundestag und führte die Teilnehmer zur CDU Zentrale, dem Konrad Adenauer Haus. Ein CDU-Mitglied trat nicht vor die friedliche Menge.

1.02.2025 Konzerthaus Berlin
Nach langer Zeit der Abwesenheit besuchte ich heute das Konzerthaus Berlin. Es dirigierte Joanna Mallwitz. Auf dem Programm standen Werke von: Sofia Gubaidulina, Dmitri Schostakowitsch und Pjotr Tschaikowsky. Tschaikowskys Musik hat mir besonderen gut gefallen. Vermutlich steht das damit in Zusammenhang, dass ich mit seiner Musik aufwuchs, sie mir vertraut ist.

26.01.2025 Matinee #Gemeinsam leben #Ohne Hass und Antisemitismus
27.1.2025 Kinofilm „Rabia – Der verlorene Traum: Gebärmaschinen für den IS“
Regisseurin Mareike Engelhardt ist in ihrem Filmdrama der Frage nachgegangen, was junge Frauen aus westlichen Demokratien dazu bringt, freiwillig nach Syrien zu reisen und wildfremde IS-Kämpfer zu heiraten? Engelhardt hat zwei junge Frauen, Jessica und Laïla, ins Zentrum ihrer Geschichte gesetzt. Beide leben in Paris, beide arbeiten in Pflegeberufen.
Heute noch am Krankenbett, schon morgen sitzen sie im Flieger, um einen IS-Kämpfer zu heiraten. Wie sie zu der Haltung kommen, erfahre ich nicht. In Syrien werden sie ein syrisches Frauen-Haus gebracht, einer Mischung aus Mädchen-Pensionat und Bordell. Dort treffen sie auf andere Frauen, die aus der ganzen Welt kommen mit ähnlichem Anliegen. Man entledigt die Angereisten ihrer persönlichen Utensilien, ihrer Identität und steckt sie in syrische Frauengewänder und halale Reizwäsche. Sie liegen zusammen in Räumen, in Fluren. „Echte, strenge Ordnung“ herrscht nur in den Gebetsräumen, an denen sie fortan arabisch sprechend teilnehmen müssen. „Indem Ihr dem Kalifat Kinder schenkt, werdet Ihr dieses Heilige Land zum Blühen bringen.“ verkündet die „Madame“, Mantra ähnlich. Sie führt das Haus rigide. Das reale Vorbild dafür gibt die berüchtigte Umm Adam, die in Raqqa – die als Kommandozentrale und wichtigster militärischer Stützpunkt des IS zwischen 2014 und 2017 galt – und am organisierten Mädchen-Handel ordentlich verdiente. Sie erwartete unbedingten Gehorsam. Wer sich widersetzt oder, wie Jessica, sich gegen sexuelle Nötigung wehrt, bleibt als niedere Putzfrau in dem Haus, wird geschlagen und brutal misshandelt – von Frauen! Männer, also die IS-Kämpfer kommen in dem Film sehr selten vor. Wenige Ausnahmen sind: als Jessica einem IS-Kämpfer in einem Zimmer mit Liege zugeführt wird von der Madame, wogegen sie sich wehrt. Oder als Laïla als Braut auserwählt wurde und für die Heirat von einer Gruppe von IS-Kämpfern abgeholt wird. Dann noch mal, als Leila grün und blau zusammengeschlagen mit ihrem kleinen Sohn ins Haus zurückkehrt und ihr Ehemann bei der Madame vorstellig wird, um seine Familie nach Hause zu holen.
Es ist ein Film über perfide Mechanismen, bei denen Unzufriedenheit über das eigene Leben die Protagonisten in eine toxische Welt bringt. Dort kann man sich entweder wiedersetzen, was das Risko qualvoll zu sterben sehr erhöht. – Oder man passt sich durch Kollaboration und Anpassung an das System an, so dass man selbst die Rolle einer Madame ähnlichen Persönlichkeit annimmt und so sein Leben verlängert.
Der Film erzählt mir nicht, was die Protagonisten dazu bewegte, Bräute der IS-Kämpfer zu werden? Der Film erzählt, wie sie in so einem Umfeld überleben oder eben nicht. Was dem Film fehlt, ist die Stimme der Is-Kämpfer, die für den Dschihad gegen die Welt der Ungläubigen kämpfen. Ich möchte sie darin sehen. Sie sind der Anfang, das Omega und das Alpha, die das Schicksal dieser Frauen besiegeln.
Fazit: Sehenswert.

25.1.2025 Ausstellungsaufbau
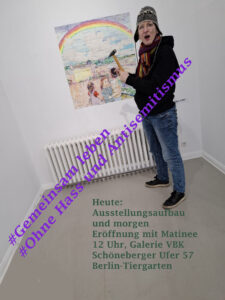
23.01.2025 Märchenoper „Hänsel und Gretel“
Besuchte die Generalprobe der Märchenoper „Hänsel und Gretel“ von Engelbert Humperdinck, in der Komische Oper. Regie führte die deutsche Schauspielerin, Sängerin und Hörspielsprecherin Dagmar Manzel. Die ersten zwei „Bilder“ bis zur Pause waren ganz „nice“. Auch die Besetzung von Hänsel, Gretel, Mutter – oh war die böse – und Vater waren gut ausgewählt. Mir gefiel auch das Bühnenbild unter Verwendung von leichten, farbigen Stoffen, Pappemachè u.a.. Leider, leider aber im dritten und letzten Bild wurde es mit Auftritt Knusperhexe problematisch. Ihr „Oma-Kostüm“ verstörte mich und in ihrem Schauspiel konnte ich leider auch nichts BÖSES erkennen. Die Hexe gab nur durch Sprache vor böse zu sein.
Als ein Fehlgriff beurteile ich auch, dass die Rolle der Hexe mit einem Tenor, statt einem Mezzosopran besetzt wurde.
Fazit: Das letzte Bild war so…, so dass ich einen Besuch dieser Aufführung nicht empfehle. Schade, schade.

20.1.2025 Zwischen legitimer Kritik, Verantwortung & Antisemitismus
Zu Gast in der Galerie VBK Ahmad Mansour, Autor, Psychologe. Nach seinem Vortrag und einem Gespräch mit der Journalistin und ehem. ARD-Korrespondentin Sabine Rau, konnten auch die Zuhörer fragen stellen.
Die Veranstaltung ist zu sehen unter: https://youtu.be/xxkP8i6jDrw

19.1.2025 Käthe Kollwitz
Bei Sonnenschein erst am Schloss Charlottenburg gezeichnet und anschließend zum aufwärmen das Käthe Kollwitz Museum besucht. Die Arbeiten von Kollwitz imponieren mir immer wieder.
Meinem Eindruck nach ist ein großer Teil ihrer Radierungen mehr eine Malerei wie eine Grafik, weil diese von Flächen nicht von Konturen bestimmt werden. Irgendwo auf einer Texttafel habe ich gelesen, dass sie Malerei studierte und auch erstmal so arbeitete. Jedoch erinnere ich mich nicht, jemals eine Malerei von Kollwitz in einer Ausstellung gesehen zu haben.
Neben Grafiken von Kollwitz selbst werden auch in einem Kabinett, Holzschnitte von ihr denen von Karl Schmidt-Rottluff gegenüber gestellt. Das ist freilich auch sehr interessant gewesen.

4.01.2025 Theaterbesuch
Mein guter Vorsatz für´s neue Jahr, regelmäßige Theaterbesuche, was heißt, 6-8 im Jahr. Das Stück „1984“ von Georg Orwell im Berliner Ensemble hat den Anfang gemacht. Die Romanvorlage ist zeitlos, aber evtl. ist es ein Problem aus einem Roman ein Theaterstück zu machen. So bin ich doch sehr müde geworden von den umfangreichem monologisierenden Textpassagen, dem eintönigen Bühnenbild, den immer den selben Garderoben, den… Es als Hörbuch zu erleben, hätte nicht weniger sinnliches erbracht. .
Fazit: Zwiespältig. Schade.

1.1.2025 Willkommen im Neuen Jahr
